



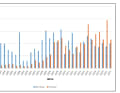
Zuletzt ließ das Umweltministerium in Schleswig-Holstein Umweltinteressierte aufhorchen, weil Minister Goldschmidt verbreitete, dass der Schweinswal jetzt derart vom Aussterben gefährdet sei, dass der Nationalpark an der Küste von Schleswig-Holstein dringend nötig wäre. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, wie sich im Interview mit Anja Gallus zeigt. Sie ist seit vielen Jahren Schweinswal-Expertin im Meeresmuseum Stralsund. Sie kennt die Unterschiede zwischen den verschiedenen Walpopulationen an der deutschen Küste und berichtet von den neusten Forschungs- und Schutzansätzen für die Tiere.
Frau Gallus, der Schweinswal kommt in der Ostsee in zwei unterschiedlichen Populationen vor, eine in der westlichen Ostsee, eine in der zentralen Ostsee, also vor Mecklenburg-Vorpommern, Bornholm, Schweden. Letztere gilt als so klein, dass sie schon lange vom Aussterben bedroht ist. Wie viele Tiere gibt es eigentlich noch, und wie werden die überhaupt gezählt?
Es gab zuletzt vor zehn Jahren erstmalig eine Zählung mit akustischen Mitteln in der zentralen Ostsee. Dafür haben alle Ostseeanrainerstaaten außer Russland an 305 Messpositionen über zwei Jahre Unterwasser-Mikrofone in einem Suchraster montiert. Daraus ergab sich, dass wir ungefähr 600 Tiere in der zentralen Ostsee haben. Diese unterscheiden sich aber von den Tieren in den Belten, die die Bootsfahrer vor allem vor der deutschen Küste antreffen.
Das klingt erstaunlich simpel und exakt. Ist das der Durchbruch für exakte Zahlen zum Bestand?
Na ja, ganz so einfach ist es nicht. Wir müssen zuerst einmal Erfahrungen sammeln: Wie oft echoortet ein Schweinswal überhaupt am Tag? In welcher Tiefe tut er das? Wie weit wird das Signal unter Wasser getragen? Wie groß ist die Gruppe, die dort jagt? Wie zuverlässig nimmt das Messgerät das Signal auf? Das ist ein Lernprozess, um Rückschlüsse zu ziehen, wie viele Tiere wirklich dort sind. Auf jeden Fall werden wir die Zählung in diesem Sommer für ein Jahr fast genauso wiederholen wie damals, um einen echten Vergleich zu haben. Das Ganze muss international ausgewertet werden, schließlich ist der Schweinswal ja eine wandernde Spezies, Staatsgrenzen spielen für die Tiere keine Rolle.
Gibt es auch Zählungen für den westlichen Teil?
Ja, die letzte Zählung 2022 ergab 14.400 Tiere für Beltsee und westliche Ostsee. Das sind leider rund 3.000 Tiere weniger als bei der letzten Zählung, die auch schon niedriger als die vorige war. In der westlichen Ostsee sowie in den Belten und Sund wird allerdings per Flugzeug gezählt. Diese Methode wurde früher auch östlich von Rügen versucht. Es gab Flugzählungen Anfang der Neunziger in der zentralen Ostsee etwa zwischen Rügen und Bornholm. Dabei gab es drei Sichtungen. Das wurde dann hochgerechnet auf das riesige Gebiet der zentralen Ostsee. So kam man auf etwa 1.900 Tiere. Das wird dann je nach Budget einmal im Jahr oder alle zwei Jahre wiederholt. Wenn man da fliegt und keine Tiere sieht, heißt das aber noch nicht, dass keine Tiere da sind. Mal reflektiert die Sonne zu stark, mal ist das Wasser zu trüb, mal sind die Tiere gerade schlicht woanders, weil sie einem Heringsschwarm gefolgt sind. Und natürlich ziehen die Tiere auch. Im Sommer wandern sie weiter in Richtung zentrale Ostsee, teils bis nach Mecklenburg Vorpommern, im Winter ziehen sie sich in die Beltsee zurück.
Die rückläufigen Flug-Zählungen in der westlichen Ostsee stehen auch in einem Widerspruch zu unseren akustischen Messungen, die eine Zunahme der akustischen Schweinswal-Signale gezeigt haben. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie dieser Widerspruch zu erklären ist. Ziehen die Schweinswale aus der westlichen Ostsee vielleicht weiter als früher? In der Nordsee gibt es immer wieder deutliche Verlagerungen der Populationen, derzeit Richtung Englischer Kanal. Wir wissen einfach wenig über das Zugverhalten der Tiere. Oder müssen sie einfach öfter nach Nahrung echoorten, weil diese schwieriger zu finden ist? Und natürlich ist die Flug-Zählung unschärfer als eine Messung der tatsächlich vorkommenden Laute, die Mikrofone messen ja 24 Stunden am Tag. Aber die Flugzählung ist weniger aufwändig und günstiger: Da sind dann drei Personen einen Tag an Bord, die zählen gesichtete Tiere, die Zahl wird hochgerechnet, damit ist das erledigt. Bei der Akustik-Methode werden die Geräte das ganze Jahr über kontrolliert, es müssen Schiffe mit Crew raus und das Equipment ausbringen und wieder bergen. Materialkosten kommen auch noch dazu.
Sie sagen, es ist nicht zu unterscheiden, ob ein Tier oder Gruppen Signale senden. In wie großen Gruppen kommen Schweinswale eigentlich vor?
Oft sind die Tiere als Mutter-Kalb-Paar unterwegs, manchmal ist auch das Kalb vom Vorjahr noch dabei. Aber oft eben auch allein. Die jungen, nicht geschlechtsreifen Tiere tun sich dagegen häufiger mal als kleine Gruppe zusammen, vielleicht so fünf Wale. Auch wenn vor Ort viel Futter zur Verfügung steht, kommen mehrere Tiere zusammen. Sie kommen aber nicht regelmäßig zu so großen Gruppen zusammen, wie man es von Delphinen oder Orcas kennt.
2007 bezifferte ein Schweinswal-Forscher den Bestand in der zentralen Ostsee auf 600 Tiere. Ist der Bestand eigentlich stabiler als gedacht?
Das Problem ist, dass beide Methoden keine völlig exakten Zahlen ergeben. Wir müssen das unbedingt verbessern. Ein Beispiel, warum: In der Bucht von Kalifornien gibt es einen Artgenossen des Schweinswals, den Vaquita. Bei einer Zählung vor etwa zehn Jahren war der Bestand bei mehreren Hundert Tieren. Da die Bedingungen aber schlecht waren für die Tiere, halbierte sich bei jeder Zählung der Bestand, bei der letzten Zählung fand man gerade noch zehn Tiere. Damit ist das Aussterben dieser Art in wenigen Jahren sehr, sehr wahrscheinlich. Der Schweinswal in der zentralen Ostsee ist dann der nächste Artgenosse auf der Liste.
900 Schweinswale verenden pro Jahr in Dänemark und Schweden in Stellnetzen
Was sind denn die Hauptprobleme, die der Schweinswal in der Ostsee hat?
Da sind an erster Stelle die Stellnetze der Fischerei zu nennen. Die sind so dünn, dass sie keine Echos reflektieren, die Wale können sie also sozusagen nicht „sehen“ oder richtiger: hören. Sie schwimmen hinein, verfangen sich und können nicht mehr zum Atmen an die Oberfläche, ersticken also qualvoll.
Gab es nicht mal eine Initiative, diese Netze alle mit Pingern auszurüsten, die die Wale vor ihnen warnen?
Es gibt eine Initiative des Landes Schleswig-Holstein, die Fischern, wenn sie diese Pinger einsetzen, im Gegenzug Vorteile zugesteht: Sie dürfen dann etwa länger fischen als sonst und auch längere Netze stellen. Es sind zwar schon Tausende der Pinger im Einsatz, aber flächendeckend sind die nicht an der deutschen oder dänischen Küste im Einsatz.
Funktionieren die denn gut? Dann wäre es doch eine gute Idee, sie einfach vorzuschreiben.
Bislang ist das ein Anreiz-Modell: Wer die Pinger montiert, bekommt Vorteile eingeräumt. Es ist aber auch nicht so einfach mit den Geräten, wie sich das alle vorstellen. Die erste Generation sorgte zum Beispiel dafür, dass sie Schweinswale abgeschreckt hat, aber dafür Robben anlockte. Die haben irgendwann gelernt, wo das Geräusch ist, steht ein Stellnetz. Die sind dann zu den Netzen geschwommen und haben sehr geschickt die Fische im Netz aufgefressen, ohne sich zu verfangen. Für Robben kein Problem. Das war dann wieder kontraproduktiv für die Fischer.
Jetzt gibt es neue, sogenannte PALs, „Porpoise Alert Sysstems“. Die senden ein aufgezeichnetes Signal eines Schweinswal-Weibchens aus, das vor Gefahr warnt. Der Hersteller sagt, das funktioniert ganz wunderbar. Es gibt aber auch Berichte aus Island, dass dort im Gegenteil sogar mehr Schweinswale als Beifang gefangen wurden, und zwar nur Männchen. Wir wissen einfach noch zu wenig über die Kommunikation von Schweinswalen, die ist kaum erforscht. Daher kann man auch nicht sagen, ob die PALs das Problem wirklich langfristig lösen oder sich die Tiere zum Beispiel in drei Jahren daran gewöhnen und die Geräte dann nutzlos sind. Dazu kommt, dass die einzelnen Schweinswal-Populationen eventuell ihren eigenen „Dialekt“ haben. Die der zentralen Ostsee unterscheiden sich von denen der westlichen Ostsee und wahrscheinlich auch von denen vor Island. Wir arbeiten gerade an einer Studie, die genau solchen Fragen nachgegangen ist, die Ergebnisse werden nächstes Jahr vorliegen.
Als das vor Jahren bekannt wurde, gab es einmal die These, dass sich die beiden in der Größe sehr unterschiedlichen deutschen Populationen aufgrund dieser Unterschiede gar nicht vermischen würden, also auch nicht stärken könnten. Ist das so?
Unsere Forschung zeigt eher, dass die Populationen zur Paarungszeit vor allem völlig andere Gebiete aufsuchen und sich daher einfach nicht vermischen. Die Wale der zentralen Ostsee wandern dafür im Sommer in Richtung Gotland, die der westlichen Ostsee bleiben in ihrer Region, auch in den Belten, wandern vielleicht auch mal bis Mecklenburg-Vorpommern oder Bornholm. Aber richtig ist, dass beide Gruppen genetische Unterschiede aufweisen. Es kann sein, dass sich daraus irgendwann einmal eine eigene Unterart entwickelt. Aber das dauert eher Jahrhunderte.
Wie weit wandern denn Schweinswale der westlichen Population überhaupt?
Es gibt dazu einige wenige Untersuchungen der Dänen. Die haben teils andere Stellnetze, eine Art nach oben offene Ringwade, die dazu führen, dass die Tiere in eine Kammer geleitet werden, aus der sie nicht mehr herauskommen, aber sie sterben nicht, weil sie noch immer an die Oberfläche zum Atmen kommen. Solche Tiere werden immer mal wieder gerettet und mit einem Sender mit Saugnäpfen versehen. Der sendet GPS-Daten, nimmt Echoortungssignale des Tieres auf und registriert, wie oft er versucht, Fische zu fangen. Die Weibchen mit ihren Kälbern sind eher ortstreu, die jungen Schweinswale und die Männchen haben weitere Zuggebiete. Aber so genau wissen wir das nicht.
Ein Schweinswal frisst täglich zehn Prozent seines Eigengewichtes
Was hat man dabei noch über die Tiere gelernt?
Zum Beispiel, dass sie manchmal hundertemal pro Stunde nach Fischen schnappen, die sie natürlich nicht alle erwischen. Aber ein Schweinswal muss jeden Tag zehn Prozent seines eigenen Körpergewichts, das können 5 bis 8 Kilo sein, fressen, um seinen großen Energiebedarf zu decken. Stellen Sie sich das mal als Mensch vor! Daraus wird klar, dass es natürlich schlecht ist, wenn der Wal bei dieser Jagd oft unterbrochen oder abgelenkt wird.
Was sind weitere Probleme des Schweinswals?
Die akustische Lärm-Verschmutzung. Das ist ein sehr vielfältiger Bereich. Natürlich könnten die Schiffsantriebe leiser sein, es wird ja auch an leiseren Propellern gearbeitet. Aber es wird auch intensiv mit starken Echolot-Geräten der Grund nach Bodenschätzen erforscht, Kabeltrassen gelegt, Fundamente für Windkraftanlagen gerammt. Die werden noch immer über viele Pfähle gegründet, die einzeln sehr laut gerammt werden. Das geht über Monate hinweg, und es wird an mehreren Stellen gleichzeitig gearbeitet. Das potenziert sich dann alles. Wenn die Windparks stehen, kommen dann die Versorger-Schiffe dazu. Schnellfähren sind auch extrem laut. Aber der Schweinswal lebt dort natürlich trotzdem, sie können ja nicht ausweichen. Die Kadettrinne ist eins der am stärksten befahrenen Gewässer der Welt, und trotzdem leben dort Schweinswale. Sie kompensieren das eben bis zu einem gewissen Grad. Es leben ja auch Menschen an Hauptverkehrsstraßen. Aber das stresst eben sowohl Mensch als auch Tier. Und der Schweinswal ist sehr viel mehr von seinem Gehör abhängig als wir, weil er darüber jagt und kommuniziert. Ein Beispiel: Die Dänen konnten mit den Sendern belegen, dass Schweinswale, wenn sich ein lautes Schiff nähert, tief auf den Grund abtauchen und dort dessen Passage still abwarten. Danach taucht das Tier schnell auf, atmet dreimal tief durch und wartet, bis sich sein stark gestiegener Herzschlag reguliert. Wenn das oft passiert, ist klar, was das für einen Stress für die Tiere bedeutet – und dass die Zeit dann für die Jagd fehlt. Da sind aber auch schon Jetskis oder schnelle Motorboote ein Problem.
Kann der Lärm denn auch lebensbedrohlich werden?
Ja leider. Wenn etwa Sprengungen von Munitionsresten auf dem Grund erfolgen, weil diese nicht mehr geborgen werden können. Die können direkt zu Verletzung und Tod führen. Wird das Innenohr verletzt, ist das Tier nicht mehr lebensfähig und stirbt praktisch sofort. Wird es geschädigt und es wird schwerhörig, beeinträchtigt das das Tier mittelfristig, es kann dann manchmal nicht mehr optimal jagen und verhungert.
Wenn man die drei größten Probleme des Schweinswals zusammenfasst, wären das dann in der Reihenfolge Treibnetze, Lärmemission und ...?
Verfügbarkeit von Futter. Die Ostsee ist stark überfischt, die Bestände sinken dramatisch, die Fische werden immer kleiner. Der Dorsch, Makrele, Hering – der Schweinswal muss immer mehr Zeit und Energie in Futtersuche investieren. Das hat Folgen: Gut die Hälfte der tot aufgefundenen Tiere in der Ostsee sind erst zwei, drei Jahre alt, also noch nicht einmal geschlechtsreif, konnten also nicht für Nachwuchs sorgen.
Waren dann alle bisherigen Schutzversuche völlig erfolglos?
Na ja, besser geworden ist etwa der Verschmutzungsgrad der Ostsee. In den Achtzigern und Neunzigern war der teils so hoch, dass die Tiere vermindert fruchtbar waren, das ist deutlich besser geworden durch die Reduzierung von ungeklärten Abwasser-Einleitungen in die Ostsee.
Die drei großen Gefahren für die Wale: Treibnetze, Lärm, Futtermangel
Es werden ja zurzeit größere Schutzgebiete gefordert, wie etwa der Nationalpark in Schleswig-Holstein. Man hört aber immer wieder, dass zurzeit noch nicht einmal die vorhandenen Schutzgebiete in der Nutzung so eingeschränkt werden, dass es dem Wal irgendetwas nützen würde. Was müsste denn geschehen, damit sich spürbar etwas bessert?
Das ist das Problem der sogenannten Paper Parcs. Die sind eingerichtet worden, weil die EU das fordert und Deutschland dem nachkommen musste. Es gibt zum Beispiel große Schutzgebiete um Fehmarn, in der Kadettrinne oder der Pommerschen Bucht. Die sind nicht explizit nur für die Wale, manchmal schützen die auch Riffe oder wichtige Vogel-Populationen. Das Problem ist oft, dass es dort keinerlei Einschränkungen für die Fischerei gibt. Es müsste größere, stellnetzfreie Flächen geben oder endlich für die Wale ungefährlichere Fangmethoden, Reusen zum Beispiel. Das würde helfen. Daran forscht das Rostocker Thünen Institut gerade. Es entwickelt ein Fanggerät, das Seevögel und Wale nicht gefährdet und dennoch bei dem erwünschten Zielfisch funktioniert.
Was verwundert hat, war, dass das Umweltministerium Schleswig-Holstein kürzlich berichtete, dass der Schweinswal der zentralen Ostsee jetzt neuerdings als vom Aussterben bedroht gilt und daher gehandelt werden müsste, und damit den Nationalpark Ostsee in Schleswig-Holstein vorantreiben will. Meines Wissens war das Tier schon seit Jahren auf dem Status eingestuft, und außerdem lebt die Population doch gar nicht vor den Küsten Schleswig-Holsteins?
Das ist dem normalen Bürger etwas schwer zu vermitteln, weil die Art im Osten erst durch neuste Forschungsergebnisse als eigene Population definiert wurde. Vorher war es eine Sub-Population. Aber richtig, der Schweinswal galt in der zentralen Ostsee auch schon vorher als vom Aussterben bedroht.
Was ich bisher rausgehört habe, ist der Bootsverkehr der Segler dann aber gar nicht das Problem der Schweinswale.
Es ist ein sehr großer Unterschied, ob wir über Segel- oder Motorboote sprechen. Wir haben ja auch ein Programm, in dem wir Meldungen von Sichtungen und Begegnungen von Skippern mit Schweinswalen registrieren (www.schweinswalsichtungen.de). Da sehen wir immer wieder, dass Schweinswale Segelboote unter Segeln begleiten, in der Bugwelle sogar springen, durchs Kielwasser tauchen, manchmal über eine halbe Stunde oder länger. Das ist bei Schiffen unter Motor äußerst selten. Wer beim Schwimmen bei der Passage eines Motorbootes mal den Kopf unter Wasser hält, weiß warum – und Schweinswale haben ein viel, viel sensibleres Gehör als wir.
Sind dann Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht vielleicht eine Lösung?
Natürlich, wir wissen ja vom Autoverkehr, wie viel es ruhiger wird, wenn Tempo 30 statt 50 gefahren wird, so ist das im Meer auch.
Okay, man sieht abschließend, ein schneller Weg zu Verbesserungen für den Schweinswal ist komplex. Wenn Sie sich eine Sofortmaßnahme wünschen dürften, die den wohl größten Erfolg versprechen würde, welche wäre das?
Schnelle Alternativen für die Stellnetze finden. Es sterben einfach viel zu viele Tiere darin.

