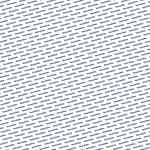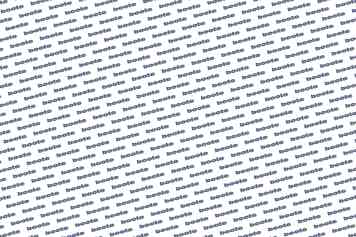Yachtrecht: Inwiefern hat die politische Lage Auswirkungen auf uns im Yachting?
Boote Exclusiv
· 05.03.2025

- Handelssanktionen gegen China?
- Mögliche Folgen für den Endkunden
- Inwiefern hätte ein militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan Auswirkungen?
- Grönland als 51. US-Bundesstaat?
- Amerikanisches Recht in Grönland?
- Der EU Green Deal – was kommt?
- Weitere Effekte auf uns im Yachting
- Experten für alle Fragen des Yachtrechts
Ein Blick auf die Schlagzeilen der letzten Wochen zeigt die Bandbreite der aktuellen Fragen. Zusammengefasst lauten diese in etwa so: „Yachting wird jetzt ‚grün‘! – Amerika überlegt, ob es Grönland kauft. – Yachten mit chinesischer Technik an Bord werden unbezahlbar.“ Schauen wir uns die Inhalte der Reihe nach an.
Handelssanktionen gegen China?
Wir erinnern uns, bereits während seiner ersten Amtszeit hat Präsident Trump die internationalen Handelsbeziehungen ordentlich durcheinandergewirbelt. Schon im Januar 2025, noch vor seiner Amtseinführung, haben die USA erweiterte Handelssanktionen gegen China erlassen. Auch zwischen der Europäischen Union (EU) und China besteht bereits seit einiger Zeit ein Handelsstreit, welcher zuletzt dazu führte, dass zusätzliche Zölle auf bestimmte chinesische Produkte erhoben werden. Drohen gegenüber China wirklich umfassende Regulierungen im Stile der Russland-Sanktionen? Was würde es für die Yachtbranche bedeuten, wenn die USA oder auch die EU umfassende Handelssanktionen gegen China erlassen?
Handelssanktionen sind ein Instrument der internationalen Politik. Sie sind der Versuch, auf die politische Willensbildung eines anderen Landes Einfluss auszuüben. Über wirtschaftlichen Druck sollen die Zielländer zu bestimmten Handlungen oder Verhaltensänderungen bewegt werden. Eine der Hauptmaßnahmen im Rahmen von Handelssanktionen sind Einfuhrzölle und Export- sowie Importverbote. Auch bestimmte Personen oder Gruppen können in den Fokus geraten. So wird der Handel beschränkt und die wirtschaftliche Entwicklung erschwert. Auf den ersten Blick ist anzunehmen, dass die Preise für Yachten von chinesischen Werften steigen würden. Diese Auswirkung wäre wohl zu vernachlässigen.
Mögliche Folgen für den Endkunden
Bei genauerem Hinsehen wird aber deutlich, dass der Einfluss auf den europäischen Yachtmarkt erheblich weiter gehen könnte. Aus China stammen viele der Aluminium- und Elektronikkomponenten, welche in Yachten verbaut sind. Spezielle Elektronik für Navigationssysteme, Kommunikationsgeräte, Motoren und Antriebe wird in China hergestellt und in „europäischen“ Yachten verbaut. Einfuhrzölle oder gar Sanktionen auf diese Komponenten hätten massive Preissteigerungen für den Endkunden zur Folge.
Auch in Europa gefertigte Yachten könnten erheblich teurer werden. In China produzierte Yachtkomponenten müssen zunächst nach Europa importiert werden. Dieser Transport in die EU ist in Hinblick auf mögliche Handelssanktionen ebenfalls zu beachten. Lieferketten könnten unterbrochen oder zumindest beeinträchtigt werden. Die Folgen sind bekannt: Verzögerungen bei der Produktion und dadurch Verzögerungen bei der Auslieferung von Yachten, erneut zusätzliche Kosten und insgesamt eine Verschiebung von Angebot und Nachfrage mit unvorhersehbaren Auswirkungen auf Preise und Verfügbarkeit. Werften und Zulieferer wären gezwungen, die erforderlichen Materialien und Komponenten von anderen Herstellern und aus anderen Ländern zu beziehen. Die Verlagerung der Produktion im Rahmen einer solch gravierenden Marktverschiebung könnte ebenfalls zu höheren Produktionskosten führen und ungeahnte preisliche Folgen haben.
Inwiefern hätte ein militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan Auswirkungen?
Eingebettet in einen militärischen Konflikt zwischen China und Taiwan wären die Folgen für die europäische Yachtbranche noch deutlicher spürbar. Die EU würde in einem solchen Fall sicherlich ernsthaft erwägen, Schritte gegen China zu unternehmen. Ob es volkswirtschaftlich überhaupt darstellbar wäre, Sanktionen in einem Umfang zu verhängen, wie sie derzeit gegen Russland in Kraft sind, bleibt eine spannende Frage. Die Folgen wären sehr weitreichend. Export- und Importverbote, dadurch Lieferengpässe und Kostenexplosion. Hersteller, Dienstleister und Kunden müssten sehr genau darauf aufpassen, dass keine Sanktionsverstöße begangen werden. Selbst Yachteigner müssten umfassende Due-Diligence-Prüfungen beim Chartern oder Kauf einer Yacht durchführen. Diese würden sich von der Frage der Gültigkeit der Verträge und der Verpflichtung zur Zahlung bis hin zu strafrechtlichen Folgen wegen eines Sanktionsverstoßes erstrecken.
Grönland als 51. US-Bundesstaat?
Der amtierende Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, hat vor seiner Amtseinführung angekündigt, Grönland in die USA eingliedern zu wollen. Die Gründe dafür sind wohl strategischer Natur. Das Vorhaben von Donald Trump rief zahlreiche Reaktionen hervor. Tatsächlich ist Donald Trump jedoch nicht der erste amerikanische Präsident, der dieses Vorhaben betreibt. Unter Präsident Truman wurden zwischen Dänemark und den USA sogar geheime Gespräche (Kaufverhandlungen?) geführt. Grund genug, einmal zu überlegen, was es bedeuten würde, wenn sich diese Vorstellung in die Realität umsetzen ließe. Hätte dies Folgen für den Yachtbereich, und wenn ja, welche?
Grönland ist tatsächlich ein zunehmend beliebtes Reiseziel. Kaum eine andere Region verfügt über eine derartige Vielfalt an Expeditionsyachten (für Charterreisen) und Erlebnisrouten. Derzeit ist Grönland eine rechtlich unabhängige Region innerhalb des Regierungssystems Dänemarks. Weitreichende rechtliche Veränderungen stünden an, wenn Grönland Teil der USA werden würde. Für die Küstengebiete Grönlands hätte dies beispielsweise zur Folge, dass amerikanische Regelungen gelten könnten. Ein Beispiel hierfür ist der sogenannte Jones Act, welcher innerhalb der USA Anwendung auf den küstennahen Verkehr findet. Durch den Jones Act werden Schiffe, welche unter US-amerikanischer Flagge fahren, privilegiert und ein gewisser Anteil US-amerikanischer Besatzung an Bord der Schiffe gefordert, um sich lizenzfrei zwischen amerikanischen Häfen zu bewegen. Dies könnte dann auch innerhalb Grönlands für Yachten und Passagierschiffe gelten. Größere Charterschiffe und Expeditionsreisen, die diesen Anforderungen nicht entsprechen, müssten extra Lizenzen erwerben.
Lesen Sie auch:
Amerikanisches Recht in Grönland?
Eine für den Yachtbereich bedeutsame Veränderung könnte auch das anwendbare Recht und der Gerichtsstand für den Fall der Eingliederung von Grönland in die USA sein. Grönland hat seit 1979 eine eigene Regierung und ein eigenes Parlament. In vielen Bereichen hat Grönland eigene Gesetze geschaffen. Würde Grönland Teil der USA werden, könnte sich diese Lage ändern und – soweit die USA die grönländischen Regelungen nicht anerkennen – amerikanisches Recht gelten.
Ein interessanter Aspekt für Versicherer. Passagiere hätten direkten Zugang zu amerikanischer Justiz und amerikanischem Recht und die bekanntermaßen weitreichenden Ansprüche wegen Personenschäden würden greifbare Realität. Der Seegang im Polarmeer beeinflusst sicher auch die Häufigkeit von Unfällen.
Der EU Green Deal – was kommt?
Vom Emissionshandelssystem der EU (EU-ETS) haben wir in dieser Kolumne bereits berichtet. Mit dem Emissionshandel soll das Ziel der Klimaneutralität der EU gefördert werden. Ausgangspunkt ist ein einfacher Grundgedanke: Der Ausstoß von CO2 wird bepreist – dafür müssen Zertifikate erworben werden, mit welchen gehandelt werden kann.
Der erlaubte (zertifizierbare) CO2-Ausstoß wird in jährlich sinkenden Obergrenzen festgelegt, was die zulässige Menge an CO2 stetig verringert. Das EU-ETS wurde 2024 auf die Schifffahrt ausgeweitet. Es gilt derzeit für Schiffe ab einer Bruttoraumzahl von 5.000 Gross Tons, was bedeutet, dass der Anwendungsberiech für Yachten (noch) eng ist. Doch der Spielraum verengt sich. Geneigte Kreise berichten, dass auf den Brüsseler Fluren bereits konkret überlegt wird, EU-ETS auch auf kleinere Schiffe, insbesondere Yachten ab 500 Gross Tons, auszuweiten. Dies würde den Yachtbereich sowohl in Bezug auf Nutzung als auch den Bau unmittelbar betreffen.
Weitere Effekte auf uns im Yachting
Fernliegend erscheint diese Erweiterung in Anbetracht der Klimaziele der EU ohnehin nicht. Es ist sogar denkbar, dass in Zukunft noch weitreichendere Anpassungen vorgenommen und auch kleinere Schiffe und Yachten in die Emissionsreduktionsziele einbezogen werden. Die Folge wäre, dass auch Eigner solcher Schiffe für ihren CO2-Ausstoß Zertifikate erwerben müssten. Die Preise dieser Zertifikate schwanken stetig, und in Anbetracht des Umstands, dass die EU die kostenlose Verteilung von Emissionszertifikaten bis 2034 schrittweise auslaufen lassen möchte, werden die Preise tendenziell eher steigen als sinken. Hinzukommen würde der zusätzliche Aufwand im Rahmen der Überwachung der Emissionen mit erhöhten Betriebskosten, welche sich auch durch erhöhte Charterpreise äußern könnten. Ein weiterer Effekt der Ausweitung des EU-ETS auf kleinere Schiffe und Yachten könnte die erhöhte Nachfrage nach klima- freundlichen Technologien sein, was deren Ausbau in Zukunft fördern würde.
Bei einer Kaufentscheidung könnten die erhöhten Kosten für nicht „klimafreundliche“ Yachten eine entscheidende Rolle spielen und dazu führen, dass der Trend in Richtung E‑Yachten geht. Ein Gros der rein elektrisch betriebenen Yachten wird in Deutschland, den Niederlanden, Slowenien und Polen hergestellt. Den obigen Erörterungen können Sie entnehmen, dass momentan viele Dinge in Bewegung geraten sind. Auf jeden Fall sind Sie jetzt mental vorbereitet.
Experten für alle Fragen des Yachtrechts

Die Yachtanwälte Dr. Tim Schommer (tim.schommer@clydeco.com) und Dr. Volker Lücke (volker.luecke@clydeco.com) betreuen seit über 18 Jahren Yachtmandate aus dem In- und Ausland. Sie beraten im Rahmen der Planungs- und Bauphase, des An- und Verkaufs, der Eignerstruktur, des Yachtbetriebs inklusive Versicherung, Crewing und Charter sowie der Abwicklung von Schäden und Ansprüchen Dritter.