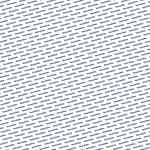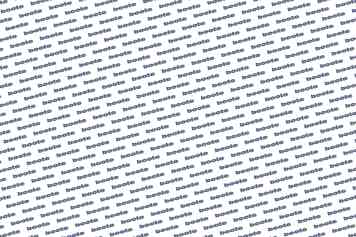Yachtrecht: Wer haftet im Fall von unbeabsichtigten Umweltschäden, wenn die Crew unüberlegt handelt?
Boote Exclusiv
· 09.09.2024

- Die generelle Fragestellung ist in allen Sachverhaltskonstellationen gleich: Wer haftet gegenüber wem und warum (oder: warum eben nicht)?
- Das Verursacherprinzip
- Sachverhalte, in denen es zu Umweltschäden gekommen ist, bedarf einer Analyse
- Fallbeispiel: Ölaustritt
- Experten für alle Fragen des Yachtrechts
Vor nicht allzu langer Zeit ist auf der griechischen Insel Hydra ein Pinienwald in Brand geraten – mutmaßlich deshalb, weil die Besatzung einer Yacht für ihre Gäste ein Feuerwerk gezündet hatte. Die Funken entfachten die trockene Vegetation der Insel und verursachten den Waldbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer nur unter Einsatz von Hubschraubern unter Kontrolle bekommen. Die Empörung unter den Einheimischen auf der Insel, und nicht nur unter diesen, war groß.
Dieser Sachverhalt bietet Anlass, einmal zu beleuchten, wer unter welchen Umständen für Umweltschäden haftet. Denn auch wenn nicht jeder Sachverhalt so irre ist, wie derjenige, der sich angeblich vor der Insel Hydra abgespielt haben soll – in der Praxis kommt es vergleichsweise oft zu mehr oder minder großen Umweltschäden. Denkbar ist zum Beispiel, dass aus (zunächst) unbekannten Gründen Öl aus einer Yacht austritt. Es passiert auch, dass ein bevorstehender Besuch des Eigners die Crew veranlasst, die Yacht so mit Reinigungsmittel zu putzen, dass das Hafenbecken kurze Zeit später in ein Blubberblasen-Meer verwandelt wird.
Die generelle Fragestellung ist in allen Sachverhaltskonstellationen gleich: Wer haftet gegenüber wem und warum (oder: warum eben nicht)?
Grundsätzlich ist zwischen zivilrechtlicher und strafrechtlicher Haftung zu differenzieren. Zusätzlich sind Haftungstatbestände aus dem öffentlichen Recht zu beachten. Im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung stellt sich die Frage, wer gegenüber dem Geschädigten für den Schaden am (Privat-)Eigentum aufkommt. Strafrechtliche Bestimmungen regeln, ob sich einer der Beteiligten strafbar gemacht hat. Die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beantworten die Frage, ob das schädigende Verhalten gegen öffentlich-rechtliche Umweltgesetze verstoßen hat.
Im Rahmen der zivilrechtlichen Haftung gilt das Verschuldensprinzip. Dies bedeutet grundsätzlich, dass ein Schädiger nur dann zivilrechtliche Schadensersatzansprüche fürchten muss, wenn er fahrlässig oder vorsätzlich einen Schaden verursacht hat. Dabei hat er sich jedoch unter gewissen Umständen die Handlungen Dritter zurechnen zu lassen. Denn er haftet im Rahmen seiner vertraglichen Haftung für seine Erfüllungsgehilfen, im Rahmen der deliktischen Haftung für seine Verrichtungsgehilfen. Der Eigner einer Yacht hat also unter gewissen Umständen für Handlungen oder Unterlassungen derjenigen Personen einzustehen, deren er sich zur Erfüllung von Verbindlichkeiten bedient, also zum Beispiel des Kapitäns. Um eine derartige Haftung für Dritte von vornherein auszuschließen, ist es nicht unüblich, das Eigentum an einer Yacht nur indirekt, also über eine Eigner-Gesellschaft zu halten. Abhängig von der Natur der Gesellschaft kann damit die eigene, persönliche Haftung ausgeschlossen oder zumindest beschränkt werden. Aus eben diesen Gründen stellen Eigner typischerweise auch nicht selbst die Besatzung ein. Sie bedienen sich vielmehr einer Crew-Agentur. Für Fehler in der Auswahl der Besatzungsmitglieder haftet dann nicht der Eigner, sondern die Agentur.
Das Verursacherprinzip
Im Gegensatz zur zivilrechtlichen Verschuldenshaftung ist die öffentlich-rechtliche Haftung für Umweltschäden durch das sogenannte Verursacherprinzip geprägt. Der Verursacher – nicht die Allgemeinheit – soll für den eingetretenen Umweltschaden haften („polluter-pays-principle“). Folglich kommt es in erster Linie entscheidend auf die unmittelbare Verursachung, weniger auf das Verschulden oder den Verschuldensgrad an. Es gibt eine Vielzahl nationaler und internationaler Regelungen zum Schutz der Umwelt. Allen gemein ist der Schutz der Rechtsgüter, die nicht privatrechtlich zugeordnet sind. Das in Deutschland zur Umsetzung der Europäischen Richtlinie 2004/35/EG geschaffene Umweltschadensgesetz (USchadG) normiert in § 2 den Umweltschaden. Ein solcher liegt vor, wenn eine Schädigung von Arten und natürlichen Lebensräumen (§ 19 BNatSchG), der Gewässer (§ 90 WHG) oder des Bodens durch Beeinträchtigung der Bodenfunktionen (§ 2 Abs. 2 BBodSchG) eingetreten ist. Nach § 2 Abs. 2 USchadG gilt als Verantwortlicher „jede natürliche oder juristische Person, die […] unmittelbar einen Umweltschaden oder die unmittelbare Gefahr eines solchen Schadens verursacht hat“.
Das Strafrecht sanktioniert strafbares Verhalten. So wird zum Beispiel im deutschen Recht mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft, wer „fremde Wälder in Brand setzt“ (§ 306 StGB). Wer unbefugt ein Gewässer verunreinigt oder sonst dessen Eigenschaften nachteilig verändert, kann mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe rechnen (§ 324 StBG).
Sachverhalte, in denen es zu Umweltschäden gekommen ist, bedarf einer Analyse
Vor dem Hintergrund dieser rechtlichen Ausgangslage müssen nun Sachverhalte, in denen es zu einem Umweltschaden gekommen ist, analysiert werden. Beginnen wir mit der Yacht, deren Besatzung verdächtigt wird, auf der Insel Hydra durch ein Feuerwerk einen Waldbrand verursacht zu haben. Im Raum steht der Vorwurf der Brandstiftung. Nicht überraschend wurde deshalb die Besatzung der Yacht unmittelbar nach Ankunft im nächsten Hafen nach der vermeintlichen Tat festgenommen. Auch in Griechenland wird der Tatbestand der Brandstiftung mit bis zu zehn Jahren Haft geahndet – selbst bei fahrlässiger Begehung. Ob sich die Besatzungsmitglieder strafbar gemacht haben, werden die strafrechtlichen Ermittlungen zeigen. Falls die Ermittlungen mit einer strafrechtlichen Verurteilung enden, haftet die Besatzung auch zivil- und öffentlich-rechtlich. Denn derjenige, der gegen ein den Schutz eines anderen bezweckenden Gesetzes verstößt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.
Lesen Sie auch:
Fallbeispiel: Ölaustritt
Weniger eindeutig ist die Rechtslage im Fall des Ölaustritts aus zunächst unbekannten Gründen. Abhängig davon, wo sich die Yacht im Zeitpunkt des Ölaustritts befand, kommt zunächst einmal eine Haftung aus den einschlägigen öffentlich-rechtlichen Umweltschutzgesetzen in Betracht. International einschlägig wäre die „International Convention On Civil Liability For Oil Pollution Damage“, welche in erster Linie dem Verursacher die Haftung zuspricht. Sobald die Ursache des Ölaustritts festgestellt wird, kommen verschiedene Schuldner einer Schadensersatzleistung in Betracht. Denkbar ist zum Beispiel, dass der Manager der Yacht nicht darauf geachtet hat, dass bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. In diesem Fall wäre er, nicht der Eigner, haftbar. Auch eine mangelhafte Wartung erscheint nicht von vornherein ausgeschlossen. Denkbar ist auch ein Fehlverhalten des Kapitäns oder des ersten Ingenieurs. In diesem Fall käme eine Haftung dieser Personen oder die des Arbeitgebers infrage.
Der die Blubberblasen im Hafenbecken verursachende Kapitän wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit öffentlich-rechtliche Vorschriften verletzt haben. Bestenfalls und abhängig vom genauen Vorwurf, wird es sich um eine Ordnungswidrigkeit handeln, die mit der Zahlung eines Bußgelds ihr Ende finden kann. Wiegen die Vorwürfe schwer(er), wird es zu strafrechtlichen Ermittlungen vor dem Hintergrund des Verdachts einer Gewässerverunreinigung kommen. Im Rahmen dieser Ermittlungen wird dann genau zu prüfen sein, was der Kapitän wusste und veranlasste. Gegebenenfalls weiten sich die Ermittlungen dann auf andere Besatzungsmitglieder aus, nämlich auf diejenigen, die auf Veranlassung des Kapitäns das Reinigungsmittel verwendet haben und ins Hafenbecken fließen ließen. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass der Kapitän auf Veranlassung des Eigners handelte. Auch für diesen könnte es dann ungemütlich und vor allem teuer werden.
Losgelöst von den Einzelheiten des jeweiligen Sachverhalts, sollte es das Ziel sein, durch kontinuierliche Prüfung des Zustands der Yacht gravierende Mängel und damit einhergehende Umweltrisiken zu vermeiden. Auch die Besatzung sollte bestmöglich geschult sein. Kommt es gleichwohl zum Feuerwerk, empfiehlt es sich, unter sofortiger Zuhilfenahme anwaltlicher Beratung mit den ermittelnden Behörden bestmöglich zu kooperieren.
Experten für alle Fragen des Yachtrechts

Die Yachtanwälte Dr. Tim Schommer (tim.schommer@clydeco.com) und Dr. Volker Lücke (volker.luecke@clydeco.com) betreuen seit über 18 Jahren Yachtmandate aus dem In- und Ausland. Sie beraten im Rahmen der Planungs- und Bauphase, des An- und Verkaufs, der Eignerstruktur, des Yachtbetriebs inklusive Versicherung, Crewing und Charter sowie der Abwicklung von Schäden und Ansprüchen Dritter.