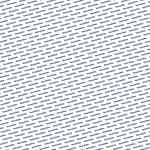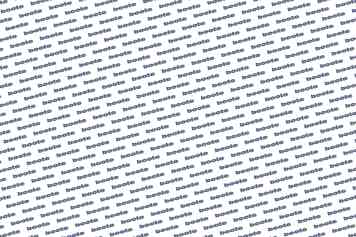Brennstoffzelle: CO2-freier Bootsantrieb wird vom Innovationszentrum Nordenham vorgestellt
Jochen Rieker
· 14.06.2024






Teuer, schwer, CO2-intensiv – so lautet bisher, knapp zusammengefasst, die Rechnung für E-Antriebe auf Yachten. Für die Umwelt bringen sie, streng genommen, mehr Schaden als Nutzen. Gleichzeitig zwingen sie die Eigner meist zu Kompromissen bei Reichweite und Geschwindigkeit unter Motor. Kein Wunder, dass sich die Technik nicht einmal ansatzweise durchgesetzt hat.
Zwei Segler wollen das ändern, beide Freunde seit 40 Jahren, beide unzufrieden mit dem Status quo. Den Anstoß gab Ralf Brauner, Professor für Meteorologie und Informatik an der Jade Universität. Vor zwei Jahren hatte er während des Round Denmark Race den Impuls, dem Wassersport zu mehr Nachhaltigkeit zu verhelfen. Einen kongenialen Partner fand er in Dieter Sichau, dem Geschäftsführer des Innovationszentrums in Nordenham. Zusammen starteten sie eine Entwicklung, die heute erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird.
Antrieb mit Brennstoffzelle ohne Lade- und Wandlungsverluste
Sie unterscheidet sich von bisherigen Ansätzen für E-Antriebe auf Yachten vor allem darin, dass sie fast vollständig auf Akkus verzichtet. Stattdessen liefert eine Wasserstoff-betriebene Brennstoffzelle die nötige Energie für den Motor direkt.
Dadurch fallen keine Umwandlungsverluste an, wie sie typisch sind beim Laden und Entladen von Batterien, zumal, wenn der Strom von einem Dieselgenerator erzeugt wird, der selbst nur eine Effizienz von 40 Prozent erreicht.
Um ihr System in der Praxis zu erproben, haben Brauner, Sichau und weitere Partner, darunter die Propeller-Gießerei SPW, Peter Frisch sowie die Boots- und Schiffswerft Cuxhaven, eine 50 Jahre alte LM 23 umgerüstet. Der Bukh-Diesel flog samt Getriebe, Welle, Tank und Starterbatterie raus. An seiner Stelle tut jetzt ein flüsterleise arbeitender 6 Kilowatt leistender E-Motor von Vetus seinen Dienst.
Er wird von einer H2-Brennstoffzelle gespeist, die 5 Kilowatt Dauerstrom leistet. Die Zelle sitzt später im ehemaligen Ölzeugschrank am Niedergang des Motorseglers. Sie wird in den nächsten Wochen geliefert. Versorgt wird sie aus einer mit bis zu 200 bar befüllten Druckflasche in der Backskiste, die für gut 60 Seemeilen Reichweite sorgt und sich mit wenigen Handgriffen austauschen lässt.
Zusätzlich verfügt die LM über eine kompakte Methanol-Brennstoffzelle (Efoy Pro 2800). Sie dient als Backup und lädt ansonsten die Verbraucherbatterie. Mit 125 Watt Leistung kann sie pro Tag 250 Amperestunden erzeugen.
Verzicht auf Lithium-Akkus sorgt für überlegene CO2-Bilanz
Die Batteriebank ist vergleichsweise schlicht gehalten. Neben einem 12-Volt-Service-Akku verfügt die “H2 Innovation” über lediglich vier AGM-Batterien von Victron à 240 Amperestunden – weniger als ein Kilowatt für den Antrieb also. Genau das macht den entscheidenden Unterschied aus. Üblich wären für ein Boot dieser Größe und dieses Gewichts eher 20 bis 25 Kilowattstunden an LiFePo-Akkus. Diese aber würden die CO2- sowie die sonstige Ökobilanz entscheidend belasten.
Um den Energieaufwand allein für die Herstellung zu kompensieren, müsste die LM mindestens fünf Jahre lang 200 bis 300 Motorstunden pro Jahr loggen – mehr, als die meisten Eignerboote je zusammenbringen.
Geht man vom derzeitigen Strommix in Deutschland aus, der nach wie vor signifikante CO2-Anteile durch Energieträger wie Gas und Kohle enthält, müsste der Motorsegler sogar mehr als 400 Betriebsstunden pro Jahr zurücklegen, um in vertretbarer Zeit nachhaltig grün zu werden. Im Durchschnitt kommen Boote in Privathand jedoch auf kaum die Hälfte.
Das bedeutet, dass ein Elektroantrieb für Akku-betriebene Yachten nie klimaneutral wird, weil die Kapazität der Stromspeicher bereits nennenswert schwindet, bevor der ökologische Break-even überhaupt erreicht ist.
Prototyp ist Teil einer Komplettlösung
Hinzu kommt: Die Infrastruktur in den Häfen ist nicht annähernd darauf vorbereitet, mehreren Yachten pro Steg ausreichend Ladestrom zur Verfügung zu stellen, um über Nacht große Mengen an Strom nachzuladen. Auch deshalb ist das Konzept der “H2 Innovation” weitaus sinnvoller als die bisherigen ohnehin kaum nachgefragten E-Antriebe von Serienwerften.
Das Innovationszentrum in Nordenham hat freilich nicht nur den Prototyp eines Brennstoffzellenantriebs entwickelt, sondern ging noch einen Schritt weiter: In den Hallen an der Werftstraße 1, wo auch Rumpf-Paneele für Airbus getestet werden, hat Dieter Sichau gleich noch einen solar betriebenen Elektrolyseur hingestellt. Das INP produziert also den Wasserstoff für die LM 23 in Eigenregie.
Die Technik, die hinter Plexiglas zu sehen ist, lasse sich “beliebig skalieren”, sagt der Geschäftsführer. Sie könne praktisch überall bedarfsgerecht den Brennstoff für die Zellen liefern. Selbst das Reinstwasser für den Prozess erzeugt das INP vor Ort, in Kürze auch Methanol für die Efoy-Brennstoffzelle.
Von Photovoltaik auf dem Dach mit Strom versorgt, braucht das System weder Umspannwerke noch armdicke Stromleitungen, um eine ganze Marina zu versorgen. Für eine Elektrolyse-Station reicht ein 20-Fuß-Container. “Man muss Mobilität einfach ganzheitlich denken und lösen”, sagt Dieter Sichau. “Dann funktioniert das auch!”
Zusammen mit Ralf Brauner will er die Technologie jetzt weiterentwickeln und das Konzept bis zur Seriennähe bringen. Denn attraktiv wird so ein Antriebskonzept erst, wenn es vom Preis her näher am etablierten Dieselmotor liegt. Im Prototypen-Status ist das noch nicht der Fall.
Allein die für die LM 23 projektierte H2-Brennstoffzelle übersteigt derzeit die Kosten für ein komplettes Dieselaggregat deutlich. Sichau ist sich aber sicher, dass die Technik mit höheren Stückzahlen wettbewerbsfähig werden kann, zumal die Kosten für ein großes Akkupaket wegfallen. Diese belasten herkömmliche E-Antriebskonzepte auf LiFePo-Basis erheblich (Aufpreis für 45-Fuß-Yachten im Vergleich zum Diesel derzeit um bzw. über 100.000 Euro).
“Eigentlich wollte ich ja etwas kürzer treten”, sagt der unternehmungslustige Manager, der schon für Siemens Gamesa das Deutschland-Geschäft geleitet und für andere Größen im Energiemarkt in verantwortlicher Position gearbeitet hat. Daraus wird vorerst wohl nichts.
Für weitere Informationen zum Brennstoffzellenantrieb und der Elektrolyse klicken Sie hier!