





- Ungewöhnliche Temperaturgegensätze
- Hitzewelle im Mittelmeerraum
- Subjektives Empfinden und wissenschaftliche Erkenntnisse
- Wetterdatensätze aus 30 Jahren ausgewertet
- Überraschende Trends ablesbar
- Deutlichste Veränderungen an der Station Kiel Leuchtturm
- Überall mehr Wind
- Tiefs als Gegenspieler
- Länger anhaltende Wetterlagen
Entweder zu wenig Wind oder zu viel. Und dann auch noch aus der falschen Richtung. Solche oder so ähnliche Sätze nimmt man nicht nur am Steg des Öfteren wahr. Auch in den Online-Foren und Wassersport-Gruppen wird das Thema heiß diskutiert.
Über Wetter wird ja grundsätzlich immer und gerne gesprochen, doch aktuell beschäftig die Szene die anhaltende und für viele scheinbar ungewöhnliche starke Westwindlag sehr. Doch ganz so außergewöhnlich ist die Lage nicht, zumindest nicht die Windrichtung. Denn grundsätzlich befinden sich Nord- wie Ostsee auf einer geographischen Breite, auf der immer wieder kühle Luftmassen aus dem Norden auf wärmere bis heiße aus dem Süden treffen. Beides als Gemisch birgt die Gefahr von starken Tiefs und auch Wetterfronten.
Ungewöhnliche Temperaturgegensätze
Somit liegt es in der Natur der Sache, dass aufgrund der Temperaturgegensätze die sich bildenden Tiefs auf dem Atlantik auch den Weg zu uns finden. Je stärker dabei die Gegensätze, desto stärker können auch die Tiefs und damit die Winde ausfallen. Vor allem merken wir das in den Herbst- und Wintermonaten mit den Stürmen, da hier die Gegensätze mit der sehr kalten Polarluft nochmals größer sind.
Doch auch in der aktuellen Phase können die Unterschiede groß sein. Denn wenn gemäßigte Luftmassen mit Werten zwischen 15 und 20 Grad auf heiße und inzwischen sogar schon sehr heiße Werte aus dem Süden mit 30 bis 40 Grad oder sogar noch mehr treffen, dann ist auch ausreichend Energie in der Atmosphäre, um die Intensität der Tiefs deutlich zu erhöhen. Damit nehmen auch die Windgeschwindigkeiten zu. Die Zutaten für stärkere Winde sind also vorhanden. Das Ganze immer in Verbindung mit einer Windrichtung um West.
Hitzewelle im Mittelmeerraum
Von den Hitzewellen im Mittelmeerraum haben wir nicht nur gehört, sondern wir haben sie auch schon Ende Juni, Anfang Juli bereits selbst spüren dürfen mit knapp 40 Grad in Deutschland. Und nach der letzten kurzen Hitzewelle wurde es auch schnell wieder wechselhaft im Wetter, vor allem auch wieder sehr windig.




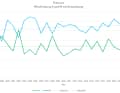
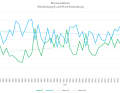
Genau aus dieser Wärme vor dem Wetterwechsel zogen die Tiefs ihre Energie und tun das teils weiterhin. Denn wenn sich über Skandinavien sogenannte Tiefkomplexe bilden, spüren wir auf Nord- und Ostsee eigentlich nur kühlere Luft und viel Wind aus Nordwest. Denn dann befinden wir uns auf der Westseite dieses Komplexes. Seine Ostflanke, auf der aus dem Süden die heiße Luft weit nach Norden getragen werden kann, liegt dabei eher im Baltikum bis teils nach Finnland hoch.
Schiebt sich dann auch noch ein neues Hoch von den Azoren über Großbritannien rein, stützt und erhöht es den sogenannten Gradienten; den Druckunterschied zwischen Hoch und Tief. Der Ausgleich zwischen beiden und damit auch der Wind fallen umso stärker aus.
Subjektives Empfinden und wissenschaftliche Erkenntnisse
Da dieses Wechselspiel nun schon etwas länger so geht und sich bisher kein Nachhaltiges Hoch über Mitteleuropa oder Skandinavien etablieren wollte, sehen wir immer wieder diese windigen Phasen, vornehmlich eben auch aus westlicher bis nordwestlicher Richtung. Allerdings darf man das menschliche Empfinden dabei nicht außer Acht lassen. Denn so ganz ungewöhnlich ist diese Phase mit dem Wind nicht.
Hinzu kommt, dass wir zwischen Februar und Mai extrem viele Schwachwindtage hatten. Es zeigten sich über Mittel- und Nordeuropa immer und immer wieder Hochdrucklagen, die uns viel Sonnenschein und kaum Wind bescherten. Ein langer Zeitraum, an den sich auch der Mensch schnell gewöhnen kann. Ist das Wetter nach so einer langen Zeit dann plötzlich doch wieder anders, mag man das womöglich als sehr ungewöhnlich wahrnehmen.
Um hier ein sauberes Bild zu zeichnen, haben meine Kollegen und ich mal die Wetterdaten diverser Stationen entlang der Ostsee ausgewertet. Hierbei haben wir uns auf die Segelsaison konzentriert, also auf die Monate Mai bis September. Wir schauten uns die Stationen, Arkona, Rostock-Warnemünde, Fehmarn, Kiel Leuchtturm und Glücksburg-Meierwik an.
Wetterdatensätze aus 30 Jahren ausgewertet
Kiel Leuchtturm ist von allen die einzige Station mitten auf dem Wasser. Nicht alle Stationen zeichnen zudem gleich lang auf. Manche sammeln Wetterdaten bereits seit 1978, andere wiederum mit stündlichen Werten erst seit 1996. Rund 30 Jahre oder mehr bekommen wir aber an allen Stationen zusammen, um ein fundiertes klimatisches Bild zu erhalten.
Um hier den Eingangssatz mit zu wenig oder zu viel Wind wieder in Erinnerung zu rufen, schauten wir dabei auf Stunden mit weniger als 6 kn Wind (unter 3 Bft) und auf Phasen mit mehr als 21 kn (ab 6 Bft). Allerdings betrachten wir hier nur den mittleren und damit stetigen wehenden Wind. Böen sind in den Datensätzen nicht berücksichtigt. Auch die Windrichtungen haben wir uns angeschaut.
Überraschende Trends ablesbar
Anhand der ermittelten Werte kann man durchaus spannende Trends und insbesondere Veränderungen erkennen. In Arkona beispielsweise gibt es kaum Änderungen bei den Schwachwindzeiten. Doch die Phasen mit starken Winden nehmen in der Segelsaison allmählich ab. Der Trend ist ziemlich eindeutig.
Auch eine östliche Windrichtung scheint in den letzten Jahren etwas häufiger vorzukommen, wenngleich die westliche weiterhin dominiert; und das bei fast allen Stationen.
Weniger Starkwindphasen sind auch in Rostock-Warnemünde zu verzeichnen. Hier ändern sich aber besonders die Windrichtung etwas auffälliger. Neben der östlichen Komponente kommen speziell die südöstliche und am stärksten die südliche Richtung immer mehr zum Tragen.
Deutlichste Veränderungen an der Station Kiel Leuchtturm
Fehmarn hat den kürzesten Datensatz, der erst bei 1996 beginnt. Hier zeigt sich als einzige Station ein Trend für mehr Westwinde, wohingegen sich die Zahlen der Schwachwind- und Starkwindphasen etwa die Waage halten.
Kiel Leuchtturm dagegen lässt ebenfalls mehr östlichen Wind zu. Indes fällt hier am stärksten auf, dass darunter besonders die Westwindrichtung leidet und weniger häufig auftritt. Und: Während der Wassersportsaison gibt es mehr und mehr Tage mit Winden über 21 kn.
In Glücksburg-Meierwik wird dagegen der ebenfalls schwächelnde Westwind mit einer stärkeren nördlichen Richtung kompensiert. Sehr interessant ist hier auch der Trend zu mehr Starkwind, aber auch gleichzeitig mehr Schwachwindphasen. An dieser Station geht die Schere am deutlichsten auseinander.
Überall mehr Wind
Welchen Schluss lassen diese Daten zu? Zunächst sehen wir über die letzten 30 bis knapp 50 Jahre Änderungen im Windverhalten. Die sind allerdings lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt. Gerade die Windgeschwindigkeiten tendieren nahezu überall in Richtung mehr Wind mit über 21 kn.
Teils sehen wir auch eine Zunahme von Schwachwindphasen. Gemein haben alle Stationen, dass andere Windrichtungen als die gewohnten vermehrt auftreten. Oft sind es mehr östliche Winde, vereinzelt auch mehr aus südlicher oder nördlicher Richtung.
Um dieses Verhalten in einen Kontext zu bringen, braucht es Wetterlagen, die es hervorrufen. Und hier sehen wir ein Muster, das passt: Es zeigen sich immer öfter Hochdrucklagen auf der europäischen Wetterkarte!
Tiefs als Gegenspieler
Die Hochs müssen dabei nicht immer direkt über Deutschland liegen. Hält sich das Hoch beispielsweise über Skandinavien, bringt es auf Ost- und Nordsee östliche Winde. Ist das Tief als Gegenspieler südlich des Hochs dann ausreichend stark, weil es viel Wärmeenergie inne hat, dann zeigt sich das auch durch stärkere Winde.
Auch, dass Glücksburg mehr nördliche Winde und Rostock-Warnemünde mehr südliche sieht, passt gut in das Bild der „neuen“ Lagen der Hochs und Tiefs. Dass hier die Starkwindphasen weniger werden, lässt sich auch mit der Ausdehnung der Hochs, vor allem eines Skandianvienhochs nach Süden erklären.
Länger anhaltende Wetterlagen
Insbesondere aber sind es die Langlebigkeiten der Hochdrucklagen, die weitere Wettersysteme blockieren und uns so über einen längeren Zeitraum ein und dieselbe Wettersituation bringen. So auch die längere Phase mit stärkerem Wind.
Weitere Hochs auf der sommerlichen Wetterkarte werden uns, anders positioniert, in den nächsten Wochen auch wieder mehr sommerliches Wetter bringen, mit sicherlich auch wieder angenehmeren Windbedingungen aus der „richtigen“ Richtung. Dennoch gilt: Auch wir Wassersportler spüren die veränderten Wetterbedingungen mittlerweile - und die Daten belegen es.

