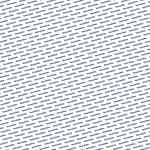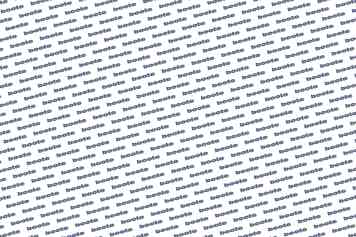Ein Text von Uwe Baykowski
“Brightwork“ sagen Skipper im englischsprachigen Raum, wenn sie die Lackoberfläche einer Yacht meinen. Und sie bringen damit so viel mehr zum Ausdruck, als es der deutsche Begriff zu sagen vermag. „bright“, das heißt „strahlend“ und „glänzend“, das heißt „leuchtend“ und „hell“; das macht Lust auf den Geruch der honigfarbenen Tinktur und das klebrige Gefühl des Pinselgriffes in der Hand. „Brightwork“ ist ein Bekenntnis dazu, das geliebte Schiff im Frühjahr wieder leuchten zu lassen, und es drückt die Hoffnung aus, das so perfekt wie möglich hinzubekommen.
Steht der Eigner vor Saisonbeginn dann an Bord, mischt sich schnell Demut in den Kanon der Frühlingsgefühle. Denn so einfach ist die Sache nicht. Selbst alte Holzwürmer geben hinter vorgehaltener Hand zu, dass ihnen die Lackierarbeit schon mal misslungen ist. Die Frühlingssonne war schon warm und täuschte über das kalte Schiff hinweg. Oder es wurde nachts bitterkalt. Jemand machte das große Hallentor auf, und Staub wirbelte herum. Die Luft war doch feuchter als geschätzt, oder es waren unbemerkte Krümel in Lack oder Pinsel. Es gibt zahlreiche Wege, die an einem strahlenden Ergebnis vorbeiführen, aber nur einen dorthin. Es darf einfach nichts schiefgehen.
Neben der Freude, die eine makellose Oberfläche verschafft, wenn der Anstrich gelingt, hat der Farbaufbau aber auch ganz handfeste Funktionen. Die Klarlacke im Überwasserbereich für Rumpf, Laibhölzer an Deck, Aufbauten, Luken, Masten und Spieren sollen die Hölzer in erster Linie vor Versprödung, Verfärbung und Öffnungen von Leimnähten schützen. Die Farbbeschichtungen für den Unterwasserbereich verhindern zu viel Feuchtigkeitsaufnahme und Fäulnisbefall. Antifouling wehrt Pocken- und Muschelbesatz ab. Die farbige Hochglanzlackierung des Freibords schließlich verleiht der Yacht die persönliche Note und vermeidet einerseits, dass das Holz austrocknet, andererseits, dass es Wasser aufnimmt. Dass all das gelingt, ist kein Hexenwerk.
Die Produkte
Für den jeweiligen Farbaufbau stehen verschiedene Systeme mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Sie werden nach dem Grad der Endhärte eingeteilt. Man unterscheidet danach zwischen Holzölen, Alkydharzlacken, Polyurethanlacken, Zweikomponentenlacken und Buntlacken.
Holzöle haben gegenüber den übrigen Lacken den Vorteil, dass sie tief ins Holz eindringen und wesentlich elastischer sind. Die Gefahr, dass die Beschichtung reißt oder abblättert, ist geringer; allerdings ist mit längeren Trockenzeiten zu rechnen. Das wohl berühmteste Öl ist das Leinöl, das aus Leinsamen gewonnen wird. Mit leinölhaltigen Produkten sind sehr gute Ergebnisse erzielt worden. Ein ebenfalls leinölhaltiges Produkt ist die gute alte Bleimennige, die jedoch für den Endverbraucher wegen gesundheitsgefährdender Wirkungen vom Markt genommen wurde. Bleimennige wurde jahrzehntelang zur Konservierung von Holz und Stahl im Yachtbau wie auch in der Berufsschifffahrt eingesetzt. Für Fachbetriebe ist sie nach wie vor zu bekommen. Sie sollte nicht durch die für jedermann erhältliche Kunstharz-Bleimennige ersetzt werden.
Produkte, die landläufig als „Bootslack“ bezeichnet werden, basieren meist auf Alkydharz. Diese Lacke sind zwar härter als die Öle, weisen aber immer noch eine sehr elastische Konsistenz auf. Sie haben in den letzten Jahren jedoch zunehmend Schwierigkeiten mit der stärkeren UV-Belastung durch Sonneneinwirkung bekommen. Die eingearbeiteten UV-Filter können in vielen Fällen die Ausbildung von unstrukturiert angeordneten, sehr feinen Haarrissen an der Lackoberfläche nicht verhindern. Die Produkte sind zwar nicht schlechter geworden, wohl aber die Umweltbedingungen. Diese Lackierungen müssen daher auch jedes Jahr erneuert werden, damit der von der Sonne abgebaute UV-Filter wieder stabilisiert wird.Polyurethan(PU)-Lacke und neuerdings auch Monourethanlacke sind noch härter und widerstandsfähiger als die Alkydharzlacke, und die Trockenzeiten sind kürzer. Die Zwischenschliffe können daher früher durchgeführt werden. Der PU-Lack zieht schneller an, was sich nachteilig auf den Verlauf auswirken kann, dann bleiben Pinselstriche sichtbar. Die erwähnte Craquelierung kann auch hier auftreten.
Am härtesten und widerstandsfähigsten, aber auch am wenigsten elastisch sind die Zweikomponentenlacke und sogar schon Dreikomponentenlacke. Bei stark arbeitenden Holzteilen, wie etwa Rahmenverbindungen an Aufbauten oder älteren verleimten Verbindungen, ist die Gefahr sehr groß, dass sie reißen. Diese Lacke ziehen ebenfalls sehr schnell an, und sie dürfen nur bei bestimmten Temperaturen und Luftfeuchtigkeiten verarbeitet werden. Ein gutes Ergebnis mit einer Pinsellackierung zu erzielen, ist deshalb schwierig, aber nicht unmöglich. Mit Spritzlackierungen können jedoch exzellente und vor allem dauerhaftere Resultate als mit einkomponentigen Lacken erzielt werden.
Buntlacke, die für Außenhaut, Wasserpass, Kajütdach und and- eres verwendet werden, basieren ebenfalls auf Alkydharz oder Polyurethan, farbige Öllacke kommen nur noch selten vor. Durch ihre Pigmentierung sind die farbigen Lacke wesentlich UV-beständiger als ihre „klaren Kollegen“. So manche Außenhaut muss nur alle zwei oder drei Jahre neu lackiert werden und nicht jede Saison, wie es bei den einkomponentigen Klarlacken unabdingbar ist. Auch unter den Buntlacken sind jene auf Polyurethan-Basis etwas kälteempfindlicher bei der Verarbeitung.
Das Unterwasserschiff
Soll ein Unterwasserschiff komplett abgezogen und wiederaufgebaut werden, ist der Rumpf vor der Konservierung auf Mängel zu untersuchen. Faule Hölzer sollten ersetzt, korrodierte Metallteile möglichst erneuert werden.
Es ist sinnvoll, den Rumpf mit einem Fungizid zu imprägnieren und vor Fäulnis zu schützen. Danach folgt ein Anstrich mit einem Chlorkautschukprimer. Auch hier gibt es noch andere Systeme; und viele Eigner klassischer Boote schwören auf die Konservierung mit Leinöl – die Entscheidung ist oft eher philosophischer Natur.
Mehr zum Thema Pflege:
Wer den Rumpf durch Spachteln glätten will, sollte dies nach der ersten Primerschicht tun, weil jetzt die Unebenheiten besser zu erkennen sind. Noch besser wäre es allerdings, den Rumpf so glatt zu schleifen, dass man auf Spachteln verzichten kann. Feine Plankennähte sollte man niemals mit einem Zweikomponentenspachtel zu schließen versuchen, weil dieser zu hart wird. Hier ist eher zu einem weichen Lackspachtel zu raten, der zwar langsam trocknet, aber nie ganz hart wird. Auch Fensterkitt, mit Leinöl „schlank“ gemacht, ist für diesen Einsatzzweck richtig. Nach dem Spachteln folgen drei weitere Schichten Primer, danach der Antifouling-Anstrich.
Metallteile
Hier geht es hauptsächlich um den leidigen Ballastkiel aus Gusseisen und die eisernen Verbände im Schiff, wie beispielsweise Bodenwrangen oder Stahlspanten bei Kompositbauweisen. Optimal wäre es, den Ballast von außen mit Epoxid zu beschichten oder stählerne Verbände etwa zu demontieren, zu strahlen und zu verzinken. Leider ist der Aufwand im letztgenannten Fall meist zu groß. Daher erfolgt die Konservierung hier mit Ölen oder Bleimennige an Ort und Stelle. Vor der Konservierung sollten die Metallteile, so gut es geht, entrostet werden. Dies kann mit der einfachen Stahlbürste oder, wenn möglich, mit einer Zopfbürste auf der Flex geschehen. Für die Konservierung bietet der Markt diverse Produkte an.
Die Bilge
Stahlschiffe oder formverleimte Rümpfe können auch im Bilgenbereich mit modernen Lacken versehen werden. Bei den konventionell geplankten klassischen Yachten, deren Holzrümpfe im Bilgenbereich immer einen Feuchtigkeitsgehalt von über 15 Prozent haben, wäre das aber nicht sinnvoll. Hier kommen Öle zur Anwendung. Die Feuchtigkeit kann dann austreten, der Rumpf kann atmen. Damit das funktioniert, muss die Bilge stets gut belüftet sein. In einem dauerhaft nassen oder auch feuchten Klima kann auch die beste Konservierung einem Pilzbefall mit nachfolgender Fäulnisbildung nicht standhalten.
Das Überwasserschiff
Gerade Neueigner von klassischen Yachten verspüren immer wieder den unwiderstehlichen Drang, das Unterwasserschiff oder auch das Überwasserschiff abzuziehen, um den Zustand der hölzernen Planken in ihrer wahren Schönheit zu sehen. Oftmals steht der Wunsch dahin- ter, einen farbig gestrichenen Rumpf wieder mit Klarlack zu versehen, was nicht selten zu Enttäuschungen führt, weil das Holz des Überwasserschiffes doch nicht so schön ist wie erwartet oder viele schwarze Stellen an den Niet- oder Schraubverbindungen das Gesamtbild beeinträchtigen. Gleichwohl ist es in vielen Fällen sinnvoll, überalterte Farbschichten zu entfernen und das langwierige und kräftezehrende Thema anzupacken.
Einige Unternehmen bieten das schonende Abstrahlen von Holzrümpfen an. Für Eigenarbeit sind zwei Methoden zu erwähnen: Abkratzen oder Abbeizen. Die letztgenannte verursacht meistens ein fürchterliches Geschmier. Außerdem arbeiten die meisten Abbeizer nur bei Temperaturen von mehr als 15 Grad vernünftig. Abschleifen funktioniert auch nicht, weil das Antifouling jedes noch so gute Schleifpapier hoffnungslos zusetzt. Für die Arbeit am Unterwasserschiff sind Kratzer mit gehärteten Klingen am besten geeignet, weil extrem harte Primerschichten unter dem Antifouling liegen können. Vom Einsatz einer Heißluftpistole sollte man beim Unterwasserschiff absehen, weil bei der Verbrennung von Farbe giftige Gase entstehen. In jedem Fall, auch beim Abkratzen und Schleifen, ist bei diesen Tätigkeiten eine Atemschutzmaske zu benutzen.
Bevor alle Farbschichten endgültig entfernt worden sind, sollte die Position des Wasserpasses durch kleine Nagelpunkte oder Einstiche mit einem Spitzbohrer in circa 0,5 bis 1 Metern Abstand gesichert werden. Sind die dicksten Farbschichten durch Abkratzen entfernt und nur noch wenige, dünne Reste auf der Außenhaut verblieben, kann das Schleifen erfolgen. Im Unterwasserbereich kann unbedenklich Maschinenhilfe eingesetzt werden. Am besten sind Exzenterschleifer mit externen Absaugern geeignet. Maschinen mit integrierten Absaugungen verteilen den Schleifstaub eher in der Umwelt oder auf der Schleiffläche.
Auch wenn das Unterwasserschiff nicht so glatt wie der Freibord sein muss, sollte man sich schon Mühe geben, eine schöne Fläche ohne Löcher und Beulen zu erzielen. Die Farbschichten am Freibord lassen sich gut mithilfe einer Heißluftpistole entfernen. Als Kratzer ist ein „Yacht-Schrabber“ empfehlenswert. Wichtig ist, dass die Klinge nicht zu dünn ist; sie kommt sonst bei der Arbeit ins Flattern und hinterlässt dadurch hässliche Riefen im Holz. Das Schleifen des Freibordes, sei er naturlackiert oder farbig, ist etwas für Könner. Je blanker die Oberfläche beim Lackieren wird, desto deutlicher werden Unebenheiten sichtbar.
Die Oberfläche kann leicht mit dem Exzenterschleifer vorgeschliffen werden, um letzte Farbschichten zu entfernen. Der Feinschliff sollte aber unbedingt von Hand mit einem Schleifbrett erfolgen, und zwar vorzugsweise zunächst in diagonaler Richtung und dann in Längsrichtung. Anfangs sollte zu grobem Schleifpapier, etwa Korn 80, gegriffen werden, dann immer feiner werdend bis Korn 120 oder 150, bei Naturlackierungen sogar bis Korn 240. Das Schleifpapier im Handel unterscheidet sich in der Qualität sehr, daher besser im Farbenfachgeschäft kaufen.
Lackieren von farbigen Bootsrümpfen
Bei farbigen Rümpfen ist anzustreben, komplett auf Spachtel zu verzichten. Leicht geöffnete Plankennähte werden aber mit weichem Lackspachtel aufgefüllt.
Hat man sich für ein Farbsystem entschieden, ob nun ein- oder zweikomponentig, sollte man unbedingt von der Grundierung bis zur Endlackierung bei diesem System bleiben; das gilt auch für die Verdünnungen. Die Grundierungsschichten, circa zwei bis vier je nach Saugfähigkeit des Holzes, können mit einer guten Schaumstoffrolle aufgetragen werden. Wenn man die angegebenen Überstreichintervalle einhält, muss kein Zwischenschliff erfolgen. Sollte man jedoch auf Spachtel nicht verzichten wollen, ist dieser nach der ersten Grundierung aufzutragen. Nach den Grundierungen muss ein Zwischenschliff erfolgen, der nun mit einer Maschine bei sehr feiner Körnung, etwa Korn 320, ausgeführt werden kann. Die Gefahr, Beulen in die Oberfläche zu schleifen, ist jetzt nicht mehr so groß. Nun kann mit der ersten Lackierung begonnen werden – eine einzige wird in der Regel nicht reichen.
Die Lackierungen können ebenfalls mit einer Schaumstoffrolle appliziert und mit einem Schaumpinsel glatt gezogen werden. Der Verlauf der Lackoberfläche hängt in erster Linie von dem Produkt selbst ab sowie von den Verarbeitungsbedingungen. Einkomponentenlacke können bei niedrigen Temperaturen mit einem Schuss Owatrol-Öl verlauffreudiger gestaltet werden. Zweikomponentenlacke können auch verdünnt werden; hier darf aber ausschließlich das angegebene Produkt zum Einsatz kommen. Zweikomponentenlacke sollten nicht aufgebracht werden, wenn die Umgebungstemperatur weniger als 10 Grad beträgt.
Lackieren von Naturrümpfen
Soll ein Rumpf vor der ersten Lackierung gebeizt werden, empfiehlt es sich, die Holzoberfläche mit einem nassen Schwamm zu befeuch- ten. Dadurch quellen die weicheren Poren und stellen sich beim Auftrocknen auf, die Oberfläche ist jetzt wieder rau. Dieser Effekt hätte sich auch nach Auftragen der Beize ergeben, die erste Lackierung wäre nun aber auf eine raue Oberfläche aufgetragen worden.
Nach dem Wässern wird die Oberfläche also noch einmal sehr fein geschliffen, dann kann gebeizt und endlich lackiert werden, gern wieder mit Schaumstoffrolle und Schaumpinsel. Am besten lässt sich diese Prozedur mit zwei Personen durchführen. Dabei sind die Verarbeitungshinweise der Lackhersteller bezüglich der Verdünnung zu beachten. Die ersten verdünnten Lackschichten können ohne Zwischenschliff innerhalb der angegebenen Intervalle aufgetragen werden, danach sollten Zwischenschliffe erfolgen.
Viele Eigner klassischer Boote schwören auf einen 400er-Nassschliff vor der Endlackierung; ein 320er-Maschinenschliff genügt jedoch. Wenn die Fläche makellos ist, reicht auch ein Abreiben mit einem Schleifpad. Das Wichtigste und Schwierigste, um ein optimales Ergebnis zu erzielen, ist die vollständige Entstaubung vor der Endlackierung. Die Flächen sollten mit einem guten Staubsauger samt Bürste abgesaugt und mit einem sauberen Lappen, beispielsweise mit Waschbenzin, abgewischt werden. Danach wird die Fläche noch einmal mit einem Staubbindetuch abgerieben.
Auch die Umgebung des Schiffes sollte einigermaßen sauber sein. Zugluft muss unbedingt vermieden werden, an Sturmtagen sollte nicht lackiert werden. Trotz Befolgung dieser Regeln verzweifeln oft selbst professionelle Yachtlackierer, weil die lackierten Flächen – im Besonderen die liegenden – Staubpartikel aufweisen. Zur Beruhigung sei hier gesagt, dass man im Wasser nichts mehr davon sieht. Eine einkomponentige Lackierung sollte mindestens acht bis zehn Schichten aufweisen. Bei den Zwischenschliffen ist darauf zu achten, dass besonders an Rundungen nicht zu hart geschliffen wird, um die Schichtdicke nicht aus Versehen wieder abzutragen.
Die Erneuerung von Naturlackierungen
Einkomponentige Naturlackierungen müssen jährlich erneuert werden, um den UV-Schutz zu stabilisieren. Es hat schon manch böse Überraschung gegeben, wenn das Lackieren mal ein Jahr ausgesetzt wurde. In der Regel ist nach der Reinigung mit klarem Wasser nur ein Anschleifen der Flächen mit feinem Papier, etwa Korn 320, ausreichend. Sind jedoch Stellen bis auf das rohe Holz oder Unterwanderungen von Feuchtigkeit vorhanden, sollte in diesem Bereich bis aufs Holz geschliffen und punktuell mit Lack, circa fünf bis acht Schichten, aufgebaut werden. Es ist zweckmäßig, diese Stellen zu bearbeiten, bevor alle Flächen durchgeschliffen werden, weil sie danach nur noch schwer auszumachen sind. Will man die Flächen vorher insgesamt durchschleifen, sind diese Stellen zu markieren.
Abkleben
Bevor Tapes auf frisch lackierte Abschnitte geklebt werden, um Flächen zum Lackieren voneinander zu trennen, sollte man sich vergewissert haben, dass der Lack ausreichend ausgehärtet ist. Andernfalls kann es passieren, dass der frische Lack beim Abreißen des Klebebandes mit abgelöst wird. Besonders im Freien ist darauf zu achten, dass die Tapes nicht zu lange auf den Flächen verbleiben – man könnte sonst Schwierigkeiten bekommen, sie wieder zu entfernen.
Die Erfolgsgarantie: worauf bei der Lackierung zu achten ist
- Die Verarbeitungsempfehlungen des Lackes sorgfältig studieren
- Lack aus dem Vorjahr filtern, um Verunreinigungen zu vermeiden
- Aus dem gleichen Grund immer aus einem separaten Gefäß streichen – nicht aus der Dose. Den Pinsel nicht am Rand abstreifen
- Die besten Ergebnisse werden mit hochwertigen Pinseln erzielt
- Neue Pinsel über Schleifpapier ziehen, um lose Haare zu entfernen
- Die Fläche unmittelbar vor dem Lackieren mit Staubbindetüchern abwischen
- Große Flächen mit der Rolle lackieren und mit dem Pinsel verschlichten
- Auf Temperatur der Luft und des zu lackierenden Materials achten
- Die Luft sollte möglichst staubfrei sein und einen Austausch erfahren – aber zugfrei
- Luftfeuchtigkeit über 80 Prozent vermeiden
- Pinsel für die Weiterarbeit am Folgetag, in Terpentinersatz hängend, aufbewahren. Vor längeren Pausen mit Pinselreiniger auswaschen, bis der Lack komplett entfernt ist, dann mit Seifenwasser. Hängend trocknen
- Zwischenschliffe beseitigen lästige Staubeinschlüsse
- Hochwertiges Klebeband verwenden. Es ist verwindungsfest, unterläuft nicht und ist rückstandsfrei zu entfernen