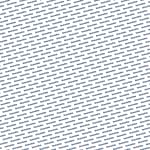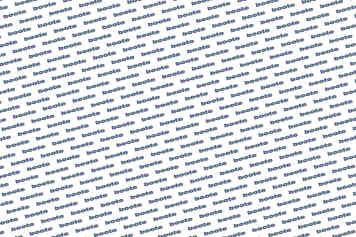Die ersten Warnungen hatte ich, wie viele andere Eigner auch, bereits Anfang der Woche gesehen und eher beiläufig registriert. Mittwoch wollte ich ohnehin den Mast legen und hoffte, in Anbetracht der Umstände einen spontanen Krantermin klarmachen zu können. Die Antwort fiel bündig aus: Sturmflut hin oder her, ohne Termin läuft gar nichts! Zwanzig andere Eigner hatten bereits die gleiche Absage kassiert, wie ich hörte. Zu diesem Zeitpunkt schien mir das nicht mehr als ein organisatorisches Ärgernis. Der Mast lag gut verschnürt auf dem Schiff, und ich hatte einen sicheren Liegeplatz in Lee von Schwimmsteg Nr. 7 im Nordhafen ergattert. Was sollte denn da groß passieren?
Erst als ich Donnerstagabend einem Freund beim Bier von meiner Kran-Abfuhr erzählte und in meiner nachträglichen Entrüstung die anrollende Sturmflut vermeintlich überzogen schilderte – Hochwasser plus Welle plus 50 Knoten Wind bei freiem Anlauf auf eine lediglich 2,5 Meter hohe Steinschüttung –, ging mir auf, dass dies wirklich ein Katastrophenszenario war.
Hatte ich wirklich alles getan?”
Ich ging ins Bett, lag wach, grübelte. Hatte ich wirklich alles getan, um das Schiff zu sichern? Um 1 Uhr stand ich wieder auf und fuhr die 50 Kilometer nach Schilksee, um nachzusehen.
Der Pegel dort lag zu diesem Zeitpunkt bei 120 Zentimetern über Normal, obwohl der Wind erst mit 25 Knoten wehte. Auf meiner „Rémy“ brachte ich zusätzliche Achterleinen mit selbst bekneifenden Schlaufen an, die sehr viel sicherer sind, weil sie nicht nach oben wegrutschen können. Warum hatte ich das nicht gleich gemacht? Danach kontrollierte ich die übrigen Festmacher sowie die Verschnürung des gelegten Mastes und war halbwegs beruhigt.
Auf dem Rückweg über den Steg jedoch erschrak ich. Ein Teil der Boote schien überhaupt nicht sturmfest gemacht. Angeschlagene Segel, einfache Festmacher, einige von diesen sogar auf Plätzen, die quer zum Wind lagen. Eine Mischung aus Ärger und Aktionismus überkam mich. Ich hüserte ungefragt mit einem Dutzend fremden Festmachern herum, wenn sie lang genug für eine Verdopplung waren, knotete fremde Genuaschoten um ungesicherte Rollfocks und postete noch in derselben Nacht bei Facebook einen entrüsteten Aufruf, sich dringend um die Schiffe zu kümmern.
Am Freitagmorgen gab es keine Zweifel mehr
Freitagmorgen checkte ich als Erstes den Pegel in Schilksee. Er zeigte 140 Zentimeter. Die Prognosen für den Höchststand waren nach oben korrigiert worden, und der Wetterwelt-Meteorologe Sebastian Wache, einer der wenigen lautstarken Mahner aus der Fachwelt, hatte seine Zurückhaltung fahren lassen und sprach inzwischen von einer „historischen Sturmflut“. Aber wo waren die offiziellen Warnungen? Der Tumult in der Community? Verdammt, warum tat denn bloß keiner was?
Der Aktionismus der vergangenen Nacht kehrte zurück. Ich fragte mich, ab wann das Wasser über die Achterdalben stieg, und rief erneut im Hafenmeisterbüro an. Dort nahm man den Gedanken ernst. Er schien also keinesfalls abwegig zu sein. Die Antwort lautete: bei zwei Meter über Normal, aber die Gefahr der abrutschenden Festmacher bestehe schon viel früher, nämlich wenn der Zugwinkel zum Boot zu steil und die Schiffsbewegungen zu heftig wären. Die Hafenmeister begrüßten mein Vorhaben, eine entsprechende Warnung zu posten, und baten anzufügen, dass man ab sofort nur noch zu zweit auf die Stege gehen sollte.
Das Wort Lebensgefahr fiel“
Mittags war ich für etwa zwei Stunden mit meiner jüngsten Tochter Janika in Schilksee. Wind und Pegel hatten entsprechend zugelegt, waren jedoch noch weit entfernt von den avisierten Peaks. Die Stege im Südhafen waren nicht mehr begehbar, die Schwimmstege im Norden nur noch mit Wathose, Trocken- oder Neoprenanzug erreichbar. Janika hatte viel an „Rémy“ mitgearbeitet und sie getauft. Sie hängt an unserem Schiff. Ich konnte sie beruhigen. Noch waren die Fender und Festmacher, die ich durchs Fernglas von Land aus checken konnte, in Ordnung. Mehrere andere Yachten waren allerdings bereits in ernsten Schwierigkeiten, speziell am Treidelsteg Nord, wo die Gischt der Brecher im Minutentakt über die Mole fegte.
Die von mir (zu Unrecht gescholtenen) Hafenmeister waren inzwischen pausenlos mit ihrem Schlauchboot im Einsatz und versuchten, ungeachtet der Gefahr für das eigene Wohl, Extraleinen auszubringen. Auch der private Yachtservice von Peer Ole Köhnen leistete Großartiges. Von der 15 Meter langen „Morningstar“, einer stattlichen IOR-Regattayacht aus den Achtzigern, die nah an der Einfahrt Nord lag und bereits schwer in Not war, musste in einem waghalsigen Manöver ein Besatzungsmitglied geborgen werden, das dort ausgeharrt hatte. Als ich um 17 Uhr in den Hafen zurückkehrte – ich hatte zwischenzeitlich Janika zu Hause abgeliefert und ein paar berufliche Dinge erledigt –, war ebendiese „Morningstar“ bereits ein Opfer der Brecher geworden. Nur noch der Mast ragte aus dem Wasser.
Ich war fassungslos“
Gemeinsam mit den zwei Dutzend durchnässten Hilfswilligen und Eignern, die hartnäckig, aber ebenso machtlos im Windschatten hinter dem Hafenmeisterbüro ausharrten, starrte ich auf dieses unfassbare Weltuntergangsszenario. Bei nunmehr dauerhaft über 50 Knoten Wind und waagerecht fliegendem Wasser – Gischt oder Regen, einerlei – schien es jetzt erst richtig an Fahrt aufzunehmen.
Wie viel schlimmer konnte es noch werden?
Mit dem Schwinden des Lichts mussten die Hafenmeister ihre Bootseinsätze abbrechen. Zu groß das Risiko für Leib und Leben, wie Volker Karner abgekämpft und zerknirscht erklärte. Stattdessen mussten sie nun zusehen, wie ihr Hafen und die Boote in ihrer Obhut vor ihren Augen in Stücke geschlagen wurden, ohne dass sie noch irgend etwas hätten tun können.
Ohnmacht ist ein unzulängliches Wort, um diese Situation zu beschreiben“
Um 18 Uhr war es Nacht. Ich zog mich in mein Auto nahe der Slipanlage zurück, wild entschlossen, bis zum bitteren Ende zu bleiben – wenn schon nicht auf, dann doch wenigstens in Sichtweite meines Bootes. Einige andere Eigner hielten es ähnlich, wie an der Reihe von gut einem Dutzend Autos neben mir zu sehen war. Ich hatte so geparkt, dass meine Scheinwerfer „Rémy“ und die beiden Nachbarboote etwa 50 Meter in Luv erfassten.
Die Scheibenwischer auf schnellster Stufe, konnte ich im Fernglas sehen, welche Gewalt die Schiffe auf und ab bocken ließ. Jeder Ruck an den Festmachern ein körperlicher Schmerz. Ein bis eineinhalb Meter Welle – im Hafen!
Was sich da draußen abspielte, war ein Horrorfilm“
Segel, die sich lösten und in Fetzen gingen. Schiffe, die sich losrissen und gegeneinanderschlugen, wieder und wieder, Yachten, die Schlagseite bekamen und quälend langsam auf Tiefe gingen.
Eine halsbrecherische Rettungsaktion
Gegen 19 Uhr telefonierte ich mit meiner Frau Katja und schilderte ihr niedergeschlagen die Lage. Sie nahm mir das Versprechen ab, keine Dummheiten zu machen und im Auto zu bleiben – ein Gelöbnis, das ich gern gab, jedoch keine halbe Stunde später bereits brach.
Ich hatte im Fernglas gesehen, dass mein linkes Nachbarboot seit einigen Minuten immer wieder heftig gegen „Rémy“ prallte. Der acht Meter lange Holzklassiker gehört meinem Freund Jochen. Es war eindeutig, dass sein linker Bugfestmacher sich verabschiedet hatte. Was sollte ich tun? Vom Auto aus zusehen, wie die Schiffe sich zerlegen? Das brachte ich nicht fertig. Also zog ich den Neoprenanzug und die Regattaweste an, die ich für genau diesen Fall mitgenommen hatte. Dann meldete ich mich bei meinem Nachbarn ab, der in seinem VW-Bus nebenan auf seine Etap 23 aufpasste. Nur für den Fall, damit jemand Bescheid wusste. Er versprach, aufzupassen und mir mit seinem Fernlicht zusätzliche Hilfestellung zu geben.
Dann watete ich durch das brusthohe, aufgewühlte Wasser zur Brückengangway von Steg 5 und hastete, gebückt gegen Sturmwind und Regen, hinaus zu meinem Boot.
Breitbeinig über den schwankenden Steg torkelnd wie ein besoffener Orang-Utan”
Komisch, wie man in solchen Momenten funktioniert. Man denkt nicht mehr an das Risiko. Die Wahrnehmung schnurrt auf einen kleinen Flecken Steg zusammen, der in den schwankenden Lichtkegel einer Laterne passt. Und auf das, was getan werden muss.
Das Erste war, Jochens Boot von meinem wegzubekommen und mit der mitgebrachten Ersatzleine zu sichern. Das war fast einfach. Dann galt es, den Mast auf meiner „Rémy“ zu retten. Die Stöße von Jochens Boot gegen meine seitlich überstehende Saling hatten ihn von den Böcken halb auf den Aufbau, halb auf das Seitendeck befördert. Zum Glück nicht ins Wasser!
Eine halbe Stunde Knochenarbeit war nötig, ihn auf dem wie irre schwankenden Boot zurück auf die Böcke zu bekommen und neu zu verschnüren. Obwohl die Situation absolut nicht lustig war, hatte sie für einen Moment doch etwas Komisches. Mein wild auf und ab gondelnder Mast hatte den Wasserhahn auf dem Steg erwischt und abgerissen, sodass ich auf dem Vorschiff plötzlich unter einer fingerdicken Druckwasserfontäne arbeitete, die es tatsächlich zielgenau auf mich abgesehen zu haben schien. Ich belegte sie lautstark mit einer hübschen Palette Schimpfworte, was mir eine gewisse Genugtuung verschaffte.
Erneute Eskalation
Dann kehrte jedoch schlagartig der Ernst der Lage zurück. Mein behelfsmäßiger Festmacher an Jochens Boot brach. Wieder hing sein Schiff an nur noch einer Vorleine und krachte gegen meines. Der allerletzte Ersatztampen, der noch übrig war, um es neu zu sichern, war Jochens Großschot. Hieß: Ich musste hinüberklettern, die Schot am Baum ausscheren und am Vorstag festknoten. Während ich das tat, brach der letzte Festmacher, und wir begannen achteraus zu segeln. Die gerade neu fixierte Schot in der Hand, rettete ich mich mit einem Hechtsprung bäuchlings zurück in mein Cockpit. Bevor auch seine Heckleinen brechen konnten, kletterte ich hastig über mein Boot nach vorn und weiter auf den Steg. Den bockigen Langkieler dann Hand über Hand in die Box zurückzuziehen, auf dem Hosenboden sitzend, mit zusammengebissenen Zähnen die Schot um einen Poller gelegt, war ein zwanzigminütiger Kampf, der im Ausgang lange offenstand. Aber irgendwann war auch das geschafft.
Während ich mich im Tauziehen mit den Brechern auf der Betonmole achteraus um Jochens Boot als Beute stritt, sie in Lee, ich in Luv, hatte die Stegbeleuchtung auf Flackerlicht umgeschaltet. Jetzt setzte sie sekundenlang ganz aus. Im Dunkeln durchfuhr es mich: Strom und Wasser gleich Stromschlag! Nichts wie weg hier und zurück an Land.
Kurz darauf stellte die Feuerwehr den Strom ab, und die Polizei sperrte die Stege. Der gesamte Hafen war nun dunkel bis auf das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge und die Scheinwerfer einiger Autos.
Der Wind hatte noch einmal draufgelegt und orgelte mit einer Gewalt, wie ich sie noch nie erlebt habe“
Später erfuhr ich, dass draußen am Leuchtturm zu diesem Zeitpunkt 71 Knoten gemessen wurden. Ich selbst hatte alle Körner aufgebraucht, physisch und psychisch. Ich tauschte den nassen Neo gegen trockene Kleidung, verkroch mich ins Auto und verbrachte die weiteren Stunden bis Mitternacht mehr oder weniger paralysiert auf meinem Beobachtungsposten. Wenn jetzt noch etwas passieren sollte, tja, dann wäre es eben so – Schicksal. Ich hatte getan, was ich konnte. Mehr war nicht drin.
Eine halbe Stunde vor Mitternacht drehte der Wind wie angesagt auf Süd und wurde schwächer. Die panisch hingefummelte Großschot-Vorleine an Jochens Boot hatte gehalten, ebenso wie die Festmacher an „Rémy“. Wir hatten Glück gehabt.
Viele andere hatten es nicht. Die Bilder des Grauens, die Schilksee bei Tagesanbruch freigab – Masten, die kreuz und quer aus dem Wasser ragten, gesunkene, an Land oder auf Pfähle geworfene Yachten, zerschlagene Stege –, haben bereits hundertfach die Runde gemacht. Aber ein Foto möchte ich erwähnen, das mir besonders an die Nieren gegangen ist. Es stammt von Rainer Görge und zeigt den Liegeplatz seiner wunderschönen Wasa „China Girl“. Die Box ist leer, nur eine Vorleine ist zu sehen, die unter Wasser verschwindet.
Unangenehme Fragen
Man möge mir verzeihen, dass ich nicht auf die Zerstörungen in Damp, Maasholm oder Arnis eingegangen bin. Dies ist mein subjektiver Bericht der Ereignisse in Kiel-Schilksee. Einer Horrornacht, die ich mein restliches Leben lang nicht vergessen werde. Man möge mir noch ein Zweites verzeihen, nämlich dass ich an dieser Stelle Fragen stelle. Unangenehme Fragen, die an uns alle gerichtet sind.
War das Drama nicht vorauszusehen?
Waren Windvorhersage, Wasserstandsprognosen, die nach Osten hin exponierte Lage der betroffenen Häfen, kurz alle notwendigen Informationen nicht vorab bekannt, unmissverständlich und rechtzeitig für jeden zugänglich?
Selbst wenn man konzediert, dass die Prognosen erst sehr spät in der Woche nach oben korrigiert wurden, hätte man zwei und zwei zusammenzählen können. Manche haben das getan und ihre Schiffe am Ostufer, in der Innenförde oder im Kanal in Sicherheit gebracht. Es ist ihnen von Herzen zu dieser Weitsicht zu gratulieren. Wir anderen – Segler, Motorbootfahrer, Vereine, Behörden – müssen uns fragen, warum wir gezögert haben. Warum wir in der trügerischen Sicherheit zu lascher Vorhersagen geglaubt haben, es wird schon nicht so schlimm kommen. Es ist sicher auch eine Frage, ob die verantwortlichen Institute ihre Glaubwürdigkeit in Gefahr sehen, wenn sie besonders hohe, alarmierende Zahlen, quasi mit Sicherheitsreserve, veröffentlichen, die dann später möglicherweise über dem realen Ereignis liegen. Die Vereine müssen sich überlegen, wie es um ihr Frühwarnsystem bestellt ist, um ihre Vernetzung und interne Informationsweitergabe im Notfall. Mensch, Leute, für jeden anderen Mist gibt es heute eine WhatsApp-Gruppe!
Als Segler und Motorbootfahrer müssen wir uns generell an die eigene Nase fassen, weil viele von uns immer noch nicht wissen (oder vergessen haben), wie man ein Schiff richtig anbindet und für einen Sturm sichert. Weil wir uns viel zu oft auf andere verlassen – Hafenbetreiber, Takelmeister, Stegnachbarn –, die sich dann um das kümmern, was eigentlich unser Job wäre. Wir müssen fragen, warum man sein Schiff mit einer – pardon – billigen Scheißleine anbindet (hier gern genommen: die ausgelutschte alte Fockschot), wenn neue zu diesem Zweck hergestellte Festmacher mit ausreichend Reck und Durchmesser die einzige Lebensversicherung bei schwerem Wetter sind.
Haben die Hafenbetreiber alles getan?
Die Kieler Sporthafen GmbH muss sich fragen lassen, warum um alles in der Welt am Mittwoch, als die Katastrophe bereits im Anmarsch war, nur Dienst nach Vorschrift gemacht wurde, anstatt in einer konzertierten Kranaktion, vielleicht auch unter Einbeziehung von Mitarbeitern anderer städtischer Häfen, noch so viele Schiffe wie möglich aus dem Wasser zu holen. Warum bestimmte Entscheidungen nicht getroffen wurden. Zum Beispiel die, das am schwersten betroffene Hafenbecken Süd zu räumen, wo hier doch sämtliche Liegeplätze an festen Stegen und quer zur angesagten Windrichtung liegen. Oder wenigstens den Treidelsteg Nord.
Hätten die Behörden reagieren müssen?
Und last, but not least die städtischen und die Landesbehörden. Sie müssen erklären, warum es nicht diesen einen großen roten Notfallknopf gibt, der gedrückt hätte werden müssen, um mit für alle deutlich hörbarer Sirene den Katastrophenfall auszulösen. Oder, wenn es diesen Mechanismus gibt, wer ihn hätte in Gang setzen müssen und warum er oder sie es nicht getan hat.
Es geht hier nicht um Schuldzuweisungen. Schuld hat der Sturm.
Es geht um Verantwortungsbewusstsein. Und zwar in seiner positiven, der Zukunft zugewandten Bedeutung. Wir werden viel aufzuarbeiten, zu reden, neu zu überdenken haben, verantwortungsbewusst, damit eine solche Katastrophe sich in Zukunft nicht wiederholen kann.