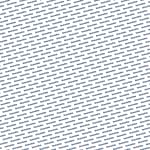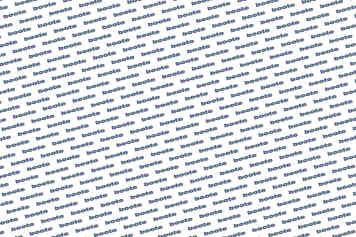Einige Wochen nach der Jahrhundertflut in der Ostsee sind auch die letzten Wracks geborgen. Nach wochenlangen Aufräumarbeiten bekommen die Hafenbetreiber langsam einen Überblick und die Bilanz ist ernüchternd: Von rund 2000 Schäden an Yachten gehen Experten mittlerweile aus, zehn bis fünfzehn Prozent davon Totalverluste. Insgesamt bekommen die Bergeexperten des Marine Claims Service (MCS) mehr als 290 Aufträge entlang der deutschen Küste. Davon sind rund 150 Yachten vollständig gesunken. Selbst in vermeintlich geschützt gelegenen Häfen wie jenem von Schleswig im hintersten Winkel der Schlei, vermeintlich im Binnenland, schlug der Sturm zu. Ein Rückblick zur Ostsee-Sturmflut
Es ist Freitag, der 20. Oktober 2023. Überall entlang der deutschen und dänischen Ostseeküste bereiten sich die Menschen auf das Eintreffen von Sturmtief Wolfgang und das begleitende Hochwasser vor. So auch Björn Hansen, Betriebsleiter des Wikinghafens in Schleswig. Die Prognosen sind finster: „Es waren 1,75 Meter mehr angesagt und dazu ordentlich Wind. Wir sind dann alle Schiffe abgegangen und haben noch mal alle Leinen korrigiert. Klar war, da kommt was auf uns zu“, erzählt er. Die Konstellation aus dem seit Tagen wehenden Starkwind aus Ost, der sich in der Nacht zu einem Sturm in Orkanstärke auswachsen würde, dazu der Wasserstand, der schon vorher deutlich höher war als normal, verheißen nichts Gutes. Zu diesem Zeitpunkt ahnt jedoch noch niemand, wie verheerend die Auswirkungen sein werden …
Langballigau
Zwei Tage später zeigt sich eine Spur der Verwüstung entlang der gesamten Küste. Nur wenige Häfen sind dabei so glimpflich davongekommen wie der in Langballigau am Südufer der Flensburger Förde. Hier liegen zu dem Zeitpunkt Norbert und Marion Krink mit ihrem Motortrawler „Marco Polo“. Ein ungeplanter Zwischenstopp auf dem Weg zum Winterlager am dänischen Egernsund. Bei schönstem Wetter waren sie einige Tage zuvor in Eckernförde aufgebrochen. Unterwegs erreicht sie die Nachricht, dass sie den Egernsund aufgrund der angesagten Windstärken nicht anlaufen können. Zu ihrem Glück ergattern sie in Langballigau einen Platz an einem Schwimmsteg. „Unser größtes Problem war zunächst, dass der Hafenmeister bereits am Mittwoch Strom und Wasser abgestellt hatte und wir darauf nicht vorbereitet waren“, erzählt Marion Krink. „Immerhin hatten wir Dieselheizung und Gasherd, aber die Lebensmittel wurden knapp“. In einer Chat-Gruppe, über die das Ehepaar Freunde und Familie auf dem Laufenden hält, schreibt sie an diesem Freitag: „Hier ist inzwischen die Feuerwehr im Einsatz und die Seenotretter sind auch vor Ort. Wir schauen fassungslos auf den überfluteten welligen Hafen, in dem jegliche Ordnung und gültige Seemannschaft aufgehoben zu sein scheint. Kein Strom, kein Frischwasser, Heizungsprobleme. Wir kommen nicht von Bord, sind vom Wasser umgeben. Der Höhepunkt ist wohl fast erreicht. Hauptsache, die Dalben, Leinen, Klampen und letztlich die Schwimmstege halten“, lautet eine der Nachrichten.
Zum Glück waren auch die Seenotretter vor Ort und halfen, die Boote an den Stegen richtig sturmfest zu machen. Trotzdem müssen die Krinks ihre Festmacher, Fender und weiteren Leinen immer wieder kontrollieren, Positionen und Längen anpassen. „Schon allein deswegen können wir nicht von Bord“, teilt sie mit.
Dass die Krinks in Langballigau an Bord bleiben dürfen, ist jedoch eine große Ausnahme. In den meisten Häfen wird den Schiffseignern von den Einsatzkräften irgendwann nahegelegt, ihr Boot zur eigenen Sicherheit zu verlassen. Überall entlang der Küste sind derweil hunderte Seenotretter und Feuerwehrleute unermüdlich im Einsatz und versuchen zu retten, was zu retten ist.
Travemünde
So auch in Travemünde, wo Patrick Morgenroth, Vormann der örtlichen Freiwilligenstation und außerdem Ausbilder bei den Seenotrettern, mit seinem Team die sich ständig verändernde Lage beobachtet und mögliche Einsätze koordiniert. „Man konnte dabei zusehen, wie der Wasserstand minütlich stieg und der Wind immer stärker wurde“, erzählt er. Tatsächlich sei seine Besatzung sogar am Freitagnachmittag noch einmal draußen auf der Lübecker Bucht im Einsatz gewesen wegen eines Surfers: „Der hatte die Gefahr, der er sich aussetzte, offensichtlich nicht erkannt.“
Der Surfer ist bei Weitem nicht der einzige, der das Risiko des Sturms in den kommenden kritischen Stunden unterschätzt. Im Wiking-Yachthafen in Schleswig muss Hafenbetreiber Björn Hansen noch in der Dunkelheit jemanden mit einem Kanu von seinem Boot retten, der bis zuletzt ausharren wollte: „Gegen zwei Uhr in der Nacht hatte der Wind etwas nachgelassen, da konnten wir ihn mehr oder weniger ohne großes Risiko bergen, nachdem uns der Hilferuf erreicht hatte.“ Hansen ist ohnehin die ganze Nacht wach und versucht, mit Eimern und Pumpen gegen die einströmenden Wassermassen der Schlei in seinem Hafenbüro anzukämpfen. „Wir hatten noch bis Freitagmittag versucht, alle Boote zu sichern. Aber ab dem Nachmittag ging nichts mehr. Da war das Wasser schon so hoch, dass wir nicht mehr sicher auf die Stege gehen konnten“, berichtet er. Die ersten Schiffe reißen sich bereits am Freitagnachmittag los. Hansen kann nur hilflos dabei zusehen – ein Schicksal, ein Gefühl der Ohnmacht, das er mit etlichen Hafenmeistern und Bootseignern an diesem Abend teilt. Denn mit Einbruch der Dunkelheit müssen vielerorts die letzten Rettungsversuche abgebrochen werden. Zu groß ist die Gefahr für Leib und Leben. In Schleswig steigt der Pegel steigt auf 2,35 Meter über dem mittleren Wasserstand. Die Fluten finden ihren Weg in eine Halle am Hafen und lösen einen Kabelbrand aus. Björn Hansen sieht sein Lebenswerk im wahrsten Sinne davonschwimmen. Es wird eine lange Nacht.
Zurück in Langballigau
Währenddessen an Bord bei Ehepaar Krink in Langballigau: „Bei dem Segler nebenan hatte sich die Rollfock gelöst, schlug umher und riss dann irgendwann. Das war ein Geräusch wie von einem Hubschrauber. Die halbe Nacht bin ich immer wieder rausgegangen und habe Fender und zusätzliche Leinen ausgebracht und kontrolliert. Die Wellen hatten gut 1,50 Meter und kamen ungebremst reingerollt“. Die Mole war längst überspült. „Das ging rauf und runter wie auf der offenen See“. Irgendwann dreht der Wind wie angekündigt auf Süd. Endlich wird es etwas ruhiger. Wer in dieser Nacht in den Häfen ein Auge zukriegt, tut es aus Erschöpfung.
Böses Erwachen nach Ostsee-Sturmflut
Am Morgen des 21. Oktober gibt es für Tausende Küstenbewohner, Bootseigner und Hafenbetreiber jedoch ein böses Erwachen. Das Ehepaar Krink in Langballigau wird schließlich evakuiert, weil Explosionsgefahr besteht. Vermutlich umhertreibende Gasflaschen. Marion Krink ist erleichtert, das Boot endlich verlassen und sanitäre Anlagen nutzen zu können. Vergeblich: Toiletten, Hafenbüro, Restaurant – alles überflutet.
Als sie von den Rettungskräften schließlich in Sicherheit gebracht werden, wird das ganze Ausmaß der Verwüstung deutlich: „Am schlimmsten hat es die Campingplätze erwischt“, erzählt Norbert Krink. „Die etwas höher gelegene Straße, die sonst als ein kleiner Deich dient, war komplett überspült. Die See lief da ungehindert rüber und hat die Wohnwagen vor sich hergetrieben. Überall lagen sie verkeilt herum.“ Die Hilfsbereitschaft der Einsatzkräfte und Anwohner ist groß, es gibt Kaffee und belegte Brötchen und ein Helfer lässt kurzerhand den Motor seines Autos laufen, damit sich das ältere Ehepaar darin aufwärmen kann. Dennoch haben sie Glück im Unglück gehabt: Während die Schäden an Land immens sind, sind die Boote in Langballigau zum Großteil verschont geblieben.
Losgerissene Leinen in Travemünde
Und auch in Travemünde ist man mit einem blauen Auge davongekommen: Als Patrick Morgenroth am Tag danach den Hafen in Augenschein nimmt, wirkt es fast, als wäre nichts geschehen. Die Seenotretter machen ein paar losgerissene Yachten wieder fest und helfen verängstigten Feriengästen von einem Hausboot an Land. Aber ansonsten können sie durchatmen. Dieses Mal. „Ich glaube, wir kommen nicht darum herum, uns in Sachen Küstenschutz und Hafeninfrastruktur vorzubereiten. Der Trend wird zum Schwimmsteg gehen, Dalben und Molen müssen höher und stabiler sein“, sagt er. Und er weiß: Längst nicht überall ist man so glimpflich davongekommen wie in Travemünde.
Auswirkungen der Ostsee-Sturmflut in Damp
In Damp zum Beispiel. Ungebremst trifft der Orkan hier auf die flache Küste Schleswig-Holsteins. Direkt davor erstreckt sich die weite Kieler Bucht, mehr als 50 Seemeilen freier Seeraum. Viel Wirkungsfläche, um die zerstörerische Kraft von Wind und Wellen zusammen mit dem Hochwasser auf ein Höchstmaß ansteigen zu lassen.
Im Hafen liegt das 11-Meter-Kajütboot von Familie Bredow aus Hamburg. Wie viele Eigner sind auch sie noch am Freitag vor Ort und versuchen, alles zu sichern. „Ich habe wieder und wieder die Leinen kontrolliert“, erzählt Heike von Bredow. „Mir überlegt, was wohl die richtige Länge ist. Nicht zu kurz, damit das Boot nicht bei steigendem Wasserstand unter Wasser gezogen wird. Er war ja kein Schwimmsteg und bereits überflutet. Aber auch nicht zu viel Spiel, damit das Boot nicht in der Box hin und her geworfen wird. Ich hatte Sorge, dass die Leinen hinten irgendwann über die Dalben rutschen, was dann ja später auch passiert ist.“
Bis in die Abendstunden hinein harrt sie mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Hafen aus und beobachtet zunehmend hilflos, wie der Sturm das Steuer übernimmt: „Man konnte nur noch zusehen, wie die Boote sich losrissen und gegeneinanderknallten. Es war furchtbar.“ Irgendwann werden sie von den Rettungskräften im Hafen gebeten, nach Hause zu fahren. Sie können ohnehin nichts mehr tun, die Situation liegt nicht mehr in ihrer Gewalt. Und sie wollen ihren Augen nicht trauen, als sie am nächsten Morgen mit flauem Gefühl im Magen zurückkommen. Bis auf ein paar Schrammen im Gelcoat ist ihr Boot unbeschädigt.
Doch der Hafen ringsum ist ein Trümmerfeld: Rümpfe liegen auf der Promenade, viele auf Tiefe. Masten ragen aus dem Wasser, Fender treiben umher. Verzweifelte Eigner suchen ihre Boote. Insgesamt 35 der rund 100 noch im Wasser liegenden Schiffe sind in der Nacht gesunken oder am Rand des Hafenbeckens gestrandet. „An den neuen Stegen waren die Klampen abgerissen. Von der Mole waren riesige Steine einfach runtergespült worden, sie war nur noch halb so hoch. Kaum vorstellbar, was da für Kräfte am Werk waren. Unsere Leinen waren so zusammengepresst, dass wir große Mühe hatten, sie zu lösen“, berichtet Heike von Bredow.
Horrorszenario in Schleswig nach der Ostsee-Sturmflut
Als Björn Hansen nach einer durchwachten Nacht übermüdet und abgekämpft seinen Hafen in Schleswig inspiziert, bietet sich ihm ein ähnliches Bild: „Es war einfach Horrorszenario. Alle Schiffe waren zusammengeschoben zu einem riesigen Pulk. Viele lagen an Land, 22 sind gesunken, gut 120 zum Teil stark beschädigt. Von der Hafenanlage waren zwar überraschenderweise 80 Prozent noch da, als das Wasser zurückgegangen war, aber das meiste davon ist Schrott. Der Schaden an der Infrastruktur des Hafens beläuft sich auf ca. 700 000 Euro“, berichtet der 34-Jährige.
„Positiv werde ich aber die Hilfsbereitschaft der Menschen am nächsten Tag in Erinnerung behalten“, erzählt er. Am Samstag seien gut 50 Helfer gekommen, nicht nur Bootseigner, auch Nachbarn, Freunde, Angehörige, die alle mit anpackten. „Das ganze Wochenende haben wir Boote geschleppt und wieder vertäut. Ohne diese Hilfe wären wir ziemlich aufgeschmissen gewesen“, sagt Björn Hansen.
Wie alle Hafenbetreiber entlang der Küste steht er nun vor der Frage, wie in Zukunft mit solchen Naturgewalten umzugehen sein wird. Die – da sind sich Klimaforscher und Meteorologen einig – zukünftig eher häufiger werden dürften. „Wir werden uns ein Konzept überlegen müssen. Vor allem, weil die Leute ihre Boote wegen der milden Winter immer länger im Wasser liegen lassen und dann im Herbst eben solche Stürme kommen können.“
Doch bevor Björn Hansen darüber nachdenken kann, wie man den Hafen zukünftig womöglich noch besser schützen kann, muss erst mal der Schaden behoben werden. Es wird Monate dauern, die Anlage wieder vollständig herzustellen – nicht nur in Schleswig. Stromanlage, Wasser, Stege – vieles muss komplett neu gemacht werden. Und dabei ist nicht nur die Finanzierung ein Thema. An Fachkräften und Material dürfte es bei der Auftragslage in diesem Winter noch mehr mangeln als ohnehin schon. Für den Moment aber ist der Betriebsleiter trotz der Folgen des Jahrhundertsturms optimistisch gestimmt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir zum Saisonstart fast wieder normal eröffnen können.“
Mehr zum Thema Ostsee-Sturmflut:
- Die Folgen der Ostsee-Sturmflut - Rückzug bis 2050?
- Goldene Zeiten für Schnäppchenjäger?
- Über 200 Totalschäden – „Schilksee gleicht einem Schlachtfeld“
- Zahlen die Versicherungen die Schäden?
- Alle Yachten müssen bis 31. Oktober geborgen sein
- Schäden an der Infrastruktur - ist die Saison 2024 in Gefahr?
- Dramatische Schilderung der Horrornacht
- Bilanz der Schäden in den Häfen
- Die Bergung der Boote durch Profis
- Düstere Zukunft für dänische Häfen