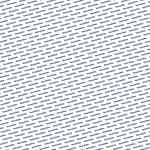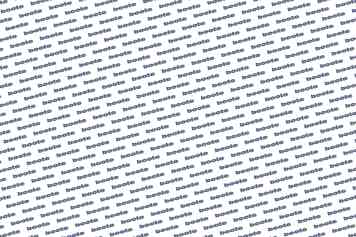Schiffshebewerk Niederfinow: Warum ein Besuch beim weltweit modernstem Schiffshebewerk lohnt
Jill Grigoleit
· 30.06.2024






- Neues und altes Schiffshebewerk laufen noch im Parallel-Betrieb
- Der Grund für das neue Schiffshebewerk Niederfinow
- Die „Kathedrale des Schiffsverkehrs“
- So funktioniert das Schiffshebewerk Niederfinow
- Die Entwicklung der Wasserbautechnik in Brandenburg
- Einblicke für Besucherinnen und Besucher im Schiffshebewerk Niederfinow
- Die Landschaft
- Die Technik
- Der Bau
- Evolution der Wasserbautechnik
Ein langer Signalton erklingt, und mehrere Zuschauer auf der Kanalbrücke zücken ihre Handykameras. Das Haltungstor, das die Brücke vom Hebewerk trennt, ist geöffnet und gibt den Weg frei in den Trog, der in luftiger Höhe zu schweben scheint. Links und rechts von ihm erhebt sich ein hellgrauer Betonriese mit blauen und gelben Stahlstreben und breiten Glasfronten. Ein polnischer Schubverband schiebt sich langsam ins Innere des imposanten Gebäudes. Gleich geht es für den tonnenschweren Verband 36 Meter senkrecht in die Tiefe. Und das, obwohl er sich auf Bergfahrt befindet.
Das Schauspiel, das sich den Zuschauern hier bietet, ist eine technische Meisterleistung. Gemeinsam mit dem vor 110 Jahren eingeweihten Oder-Havel-Kanal, den historischen Schleusentreppen und dem über 400 Jahre alten Finowkanal bilden die beiden beeindruckenden Hebewerke in Niederfinow ein weltweit einzigartiges Ensemble der Ingenieurskunst und des Wasserbaus.
Neues und altes Schiffshebewerk laufen noch im Parallel-Betrieb
Das neue Schiffshebewerk Niederfinow Nord ist ein Bauwerk der Superlative. In dem 55 Meter hohen und knapp 400 Millionen Euro teuren Schiffsfahrstuhl wurde mehr Stahl als im Pariser Eiffelturm verbaut. Im Oktober 2022 wurde es nach 14 Jahren Bauzeit eingeweiht. Seither läuft es vorerst im Parallel-Betrieb mit dem ältesten noch aktiven Schiffshebewerk Deutschlands direkt nebenan. Als Letzteres vor genau 90 Jahren – nach nur acht Jahren Bauzeit – seinen Dienst aufnahm, galt es als das größte Schiffshebewerk der Welt.
Und auch wenn es diesen Titelnach 40 Jahren abtreten musste, hat es seine Anziehungskraft auf Technikfans aus aller Welt bis heute nicht verloren. Noch bis voraussichtlich 2027 soll es in Betrieb bleiben, um bei Ausfällen des Nachfolgers einzuspringen. Und tatsächlich erwies sich dieses Back-up als sinnvoll, denn das neue Hebewerk hatte in den ersten zwei Jahren mit einigen Kinderkrankheiten zu kämpfen und musste mehrfach nachjustiert werden.
Das alte Hebewerk hingegen hat in 90 Jahren gerade mal 50 Ausfalltage zu verzeichnen. Selbst nach Kriegsende stand es nur für wenige Monate still – und das nicht aufgrund technischer Mängel, sondern wegen des Dieselmangels.
Mehr zum Schiffshebewerk Niederfinow:
Der Grund für das neue Schiffshebewerk Niederfinow
Doch wieso war dann überhaupt ein neues Hebewerk nötig? Damit künftig mehr Güter klimafreundlich über das Wasser transportiert werden können, müssen Wasserwege und -bauten auf immer mehr und immer größere Schiffe ausgelegt sein. Im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 wird die Havel-Oder-Wasserstraße umfangreich modernisiert. Künftig sollen auf der gesamten Strecke Schiffe mit einer Länge von 115 Metern, einer Breite von 11,45 Meter und einem Tiefgang von 2,80 Meter verkehren können, die zwei Lagen von Containern fassen können.
Diesen Anforderungen wurde das alte Hebewerk nicht mehr gerecht. Für Schubverbände ist es zu kurz. Mit jährlich etwa 11 000 Schiffen ist es an seine Kapazitätsgrenze gestoßen. Deshalb wurde 1997 der Neubau eines größeren Hebewerks beschlossen. Schubverbände mit drei Leichtern dürfen im neuen Hebewerk bis zu 114 Meter lang sein. Und auch die Durchfahrtshöhe wurde auf 5,25 Meter erhöht. Damit erfüllt das Bauwerk die Kriterien der zweithöchsten europäischen Wasserstraßenklasse V. Das zulässige Gesamtgewicht liegt nun bei 2300 Tonnen anstatt 1000 Tonnen. Um den schwereren Trog zu heben, mussten schwerere Gegengewichte her. Sie bringen rund 9000 Tonnen auf die Waage, mehr als doppelt so viel wie die des alten Hebewerks.
Die „Kathedrale des Schiffsverkehrs“
Schon jetzt wird das neue Schiffshebewerk in Ingenieursbaukreisen als Jahrhundertbauwerk bezeichnet, als „Kathedrale des Schiffsverkehrs“ gar. Von den ersten Planungen 1992 bis zum Baubeginn vergingen 16 Jahre, bis zur Einweihung weitere 14 Jahre. Ein langer Weg im Vergleich zur Entstehung des Vorgängers. Doch abgesehen davon, dass man heutzutage mehr Wert und Rücksicht auf Arbeitssicherheit und Umweltschutz legt, ist die verbaute Technik auch um einiges aufwendiger als noch vor 100 Jahren. Während im alten Hebewerk fünf Mitarbeiter pro Schicht im Einsatz sind, steuert beim Nachbarn nur noch eine Person den automatisierten Ablauf vom Monitor aus.
So funktioniert das Schiffshebewerk Niederfinow
Das Grundprinzip aber ist das Gleiche: Beide Senkrechthebewerke basieren auf dem Prinzip des Gewichtsausgleichs. 2300 Tonnen schwere Schiffe können hier per Knopfdruck 36 Meter in die Höhe gehoben werden. Das klingt nach enormem Energieaufwand. Ist es aber nicht – denn tatsächlich wird der Trog nicht gehoben, er klettert. Das Prinzip ist simpel: Würde man versuchen, einen 50 Kilogramm schweren Betonblock per Hand zu heben, müsste man viel Kraft aufwenden. Legt man aber ein Seil über eine Rolle und befestigt an beiden Seiten einen Block von gleichem Gewicht, sodass beide frei in der Luft schweben, kann man diese mit Leichtigkeit hoch und runter bewegen.
Lediglich um die Trägheitsmomente und Reibungsverluste bei Rolle und Seil auszugleichen, braucht es noch etwas Krafteinsatz. Diesen liefern acht Motoren mit jeweils 218 PS. Große Zahnräder, sogenannte Antriebsritzel, die am Trog befestigt sind, klettern eine Zahnstockleiter am Hebewerksgerüst hoch und runter. Sogenannte Mutterbackensäulen sorgen für die Absicherung im Havariefall. Sie sind längs geschlitzt und haben im Inneren ein Gewinde, in dem sich ein Drehriegel auf und ab bewegen kann. Wenn zum Beispiel Wasser aus dem Trog läuft und das Gleichgewicht gestört wird, setzt sich der Drehriegel fest und sichert so den Trog, damit dieser nicht abstürzt. 224 dicke Stahlseile halten den Trog und die insgesamt 9000 Tonnen schweren Gegengewichte. Sie werden über 112 Seilscheiben geführt, die einen Durchmesser von mehr als drei Metern haben. Das Gewicht des Trogs bleibt immer gleich, egal ob ein tonnenschweres Binnenschiff oder ein einsamer Kajakfahrer in der Wanne liegt. Dieses Prinzip der Verdrängung hatte Archimedes bereits vor über 2000 Jahren beschrieben.
16 Minuten nach der Einfahrt erreicht der polnische Schubverband die Talsohle. Mit dem alten Hebewerk hätte der Vorgang 20 Minuten gedauert – vor 90 Jahren bereits eine Revolution. Denn bis zur Einweihung des ersten Fahrstuhls 1934 brauchten die Schiffe über die Schleusentreppe noch fast zwei Stunden. Und auch diese galt nur zwanzig Jahre vorher noch als Weltsensation.
Die Entwicklung der Wasserbautechnik in Brandenburg
Die Entwicklung der Wasserbautechnik in Brandenburg hängt mit den außergewöhnlichen Begebenheiten der Region zusammen. Denn bei Niederfinow stößt das Eberswalder Urstromtal an die Schorfheider Platte. Als sich die Gletscher nach dem Ende der letzten Eiszeit zurückzogen, hinterließen sie einen Geländesprung von 36 Metern Höhe. Auf der einen Seite floss das Schmelzwasser Richtung Nordsee, auf der anderen Seite in Richtung Ostsee. Um die beiden Flusssysteme miteinander zu verbinden, mussten sich die Menschen etwas einfallen lassen.
Das neue Schiffshebewerk Niederfinow Nord ist bereits das vierte Zeugnis dieser menschlicher Kraftanstrengung, sich den Begebenheiten anzupassen. Jahrhundertelang bestimmte der Finowkanal mit den Ausmaßen seiner zwölf Schleusen auf 30 Kilometern die maximale Schiffsgröße. Auf dem später erbauten Oder-Havel-Kanal entstand dann eine mächtige Schleusentreppe mit vier Stufen, wo der Höhenunterschied kompakt an einem Ort überwunden wurde. Zum damaligen Zeitpunkt ein neuer Weltrekord. Doch für die jeweils neun Meter pro Kammer benötigten die Schiffe immer noch jeweils 20 Minuten. Und der Wasserverbrauch war enorm.
1934 folgte deshalb der erste Fahrstuhl, mit dem der Höhenunterschied sehr viel wirtschaftlicher überwunden werden konnte. Mit jährlich mehr als 150000 Besuchern aus aller Welt sind die Schiffshebewerke eines der wichtigsten touristischen Ziele Brandenburgs.
Einblicke für Besucherinnen und Besucher im Schiffshebewerk Niederfinow
Das wurde bei der Planung des neuen Hebewerks mitgedacht: Vom Besucherumgang in 40 Metern Höhe kann man das Heben und Senken der Schiffe miterleben. Glasscheiben geben den Blick auf die riesigen Seilrollen frei. Von den Plattformen bietet sich ein einzigartiger Blick über die Landschaft des Niederoderbruchs.
Beide Hebewerke können zum Teil auf eigene Faust begangen und über geführte Touren weiter erschlossen werden und bilden gemeinsam mit der Ausstellung im Informationszentrum ein spannendes Ensemble der Technikgeschichte. Auch die Passage auf eigenem Kiel ist ein außergewöhnliches Erlebnis und kostenfrei. Welches der beiden Hebewerke dabei durchfahren wird, ist aber dem Zufall, beziehungsweise der Verkehrssituation, überlassen.
Über Gastliegeplätze für Sportboote verfügt das Gelände derzeit noch nicht. Es gibt aber bereits Planungen für einen öffentlichen Anleger im unteren Vorhafen. Wer nicht mit dem eigenen Boot anreist und trotzdem nicht auf das Erlebnis verzichten möchte, kann die Fahrt im Aufzug auch auf einem der Fahrgastschiffe erleben. Mehrmals täglich starten die Schiffe am Anleger in der Nähe des Besucherparkplatzes. Eine Besichtigungsfahrt dauert etwa eine Stunde und kostet acht Euro.
Die Landschaft
Die Hebewerke gleichen den Geländesprung zwischen Urstromtal und der Platte des Barnims aus. Hier verläuft die Hauptwasserscheide zwischen Ost- und Nordsee. Um diese beiden Flusssysteme zu verbinden, brauchte es eine künstliche Wasserstraße, die den Höhenunterschied überwindet.
Die Technik
Senkrechthebewerke basieren auf dem Prinzip des Gleichgewichts. Gegengewichte lassen den immer gleich schweren Trog mit wenig Kraftaufwand in die Höhe klettern. Durch das Prinzip der Verdrängung bleibt das Gewicht des Trogs immer gleich.
Der Bau
Das neue Schiffshebewerk ist 133 Meter lang, knapp 46 Meter breit und fast 55 Meter hoch. Der Trog bietet Platz für Schiffe mit bis zu 110 Meter Länge (114 Meter im Schubverband), 11,45 Meter Breite und einem Tiefgang von 2,80 Meter.
Evolution der Wasserbautechnik
In Niederfinow finden sich mehrere Zeugnisse aus der mehr als 400-jährigen Geschichte des Baus künstlicher Wasserstraßen. Vom Finowkanal mit seinen zwölf Schleusen über die Schleusentreppe mit vier Kammern und das 1934 eröffnete Schiffshebewerk bis zum modernsten Schiffshebewerk Deutschlands.