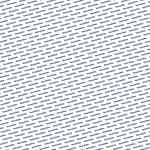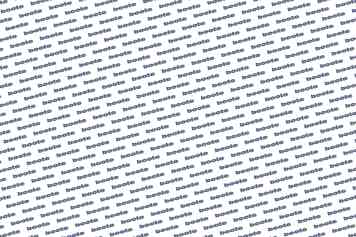Ausstattung: Das ist bei Installation und Wartung einer Gasanlage wichtig






Die Tatsache, dass fast alle Serienschiffe mit Gasherden ausgestattet sind, unterstreicht die Verlässlichkeit dieser Systeme. Bei korrekter Installation und Wartung ist eine Gasanlage im Alltag nicht riskanter als andere Brennstoffe. Der Komfort in der Nutzung führt jedoch oft dazu, dass man die notwendige Mindestwartung und Überprüfung vergisst. Anders als beim Petroleumkocher ist ein Leck in der Gasleitung nicht sichtbar.
Lesen Sie auch:
Die internationale Norm ISO 10239 und das Arbeitsblatt G 608 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (DVGW) regeln, wie Anlagen bei privat genutzten Wasserfahrzeugen bis 25 Meter Länge gestaltet sein müssen. In Deutschland schreibt man zudem regelmäßige Überprüfungen alle zwei Jahre vor, nicht nur die Kontrolle der Erstinstallation. Obwohl diese Richtlinien gesetzlich nicht verbindlich sind, sollte jeder Eigner trotzdem darauf achten. Denn im Schadensfall fordert die Versicherung Informationen über die Gasanlage und ob sie den aktuellen technischen Standards entspricht. Dabei dienen die DVGW-Vorgaben als Orientierung.
Gas an Bord lagern
Je nach verwendetem Flaschenformat wird entweder Butan in den blauen Campingaz-Flaschen oder Propan an Bord genutzt. Die beiden Brennstoffe unterscheiden sich zwar in Chemie und Preis, praktisch aber kaum. Sowohl Heizung als auch Herd funktionieren mit beiden Energieträgern ohne Anpassungen. Welches Gas an Bord genutzt wird, hängt von Platzverhältnissen und Revier ab, da Butan und Propan verschiedene Siedepunkte haben. Reines Butan wird erst bei Temperaturen über null Grad Celsius gasförmig, während reines Propan schon ab minus 42 Grad verdampft.
Daraus ergibt sich eine wichtige Einschränkung: Butan ist nicht wintertauglich. Wer etwa zu Ostern bei Frost mit einer blauen Campingaz-Flasche unterwegs ist, könnte Probleme haben. Bei zu niedrigen Temperaturen verdampft kein Gas mehr, und Heizung sowie Herd bleiben kalt. Da die Gewinnung von reinem Butan oder Propan aufwendig ist, handelt man in der Praxis immer mit Gasgemischen. Die blauen Campingaz-Flaschen funktionieren daher bis etwa minus fünf Grad, was den meisten Seglern ausreicht. Wegen der kalten Winter ist Butan in Skandinavien schwer zu bekommen; dort setzt man auf Propan.
Die Gasinstallation im Überblick






Ein weiterer Unterschied der Siedepunkte von Propan und Butan liegt in ihrer unterschiedlichen thermischen Ausdehnung. Bei 20 Grad hat eine mit Propan gefüllte Flasche etwa 7 bar Druck, während eine Butanfüllung nur 1,2 bar erreicht. Daher können Campingaz-Flaschen dünnwandiger und leichter sein. Sie dürfen jedoch nie mit mehr Propan befüllt werden, da sie dem Druckanstieg bei Erwärmung nicht standhalten würden.
Propan und Butan sind schwerer als Luft, sodass austretendes Gas sich stets am tiefsten Punkt sammelt, bei Booten in der Bilge. Deshalb gehört der Behälter in einen gasdichten Kasten. Der Regler auf der Flasche hat ein Sicherheitsventil, das die Anlage vor zu hohem Druck schützt. Sollte es auslösen, muss das Gas nach außen abfließen können. Daher braucht der Gaskasten an der tiefsten Stelle einen Ablauf von mindestens 19 Millimeter Durchmesser, der über der Wasserlinie endet. Dies lässt sich mit einer Pütz Wasser überprüfen: Der Behälter muss vollständig ablaufen, ohne Pfützen zu hinterlassen.
Bei modernen Booten ist meist ein entsprechender Stauraum vorgesehen. Wer von Spiritus oder Petroleum auf Gas umsteigt und nachrüsten muss, kann fertige Gaskästen nutzen.
Diese sind ab 150 Euro für eine Zwei-Kilogramm-Flasche erhältlich. Alternativ kann man eine Sperrholzkiste auf Maß bauen und von innen mit GFK verkleiden. Selbstbaulösungen aus einem 250 Millimeter Abflussrohr sind genau so möglich. Aus einem Stück mit Muffe und einem passenden Stopfen lässt sich leicht ein runder Gaskasten zusammenstellen. Die Reserveflasche sollte ebenfalls in der Gaskiste stehen, da auch bei nicht angeschlossenen Flaschen ein defektes Ventil Gas austreten lassen könnte.
Wird der Flaschenkasten in einer nicht abgedichteten Backskiste oder einem anderen Raum installiert, braucht er einen dichten Deckel. Ist er im Ankerkasten, müssen die Anschlüsse und Flasche vom Ankergeschirr getrennt und ein eigener Abfluss vorhanden sein. Jedoch kann die Installation im feuchten Ankerkasten zu Korrosion an Regler und Flaschen führen. Zündquellen gehören nicht in den Flaschenkasten. Wer eine elektrische Ankerwinsch hat, sollte den Kasten komplett abdichten oder besser achtern einbauen.
Druck regeln
Der Druck in einer Flasche variiert je nach Umgebungstemperatur. Bei Propanflaschen beträgt der Druck bei 20 Grad etwa 7 bar und bei 15 Grad nur 5,5 bar. Damit Kocher und Heizung gleichmäßig arbeiten, muss der Betriebsdruck konstant bleiben. Dafür sorgt der Regler, der den Druck auf die benötigten 50 oder 30 Millibar reduziert. Bis 1996 waren in Deutschland 50-Millibar-Anlagen vorgeschrieben, mittlerweile hat man sich international auf 30 Millibar geeinigt. 50 Millibar sind jedoch weiterhin erlaubt. Besitzer eines alten Herdes oder einer alten Heizung müssen also nicht umrüsten. Wichtig ist, dass nur ein Druck für alle Verbraucher an Bord gilt. Die meisten Herde für den Yachteinsatz sind auch weiterhin in beiden Varianten erhältlich. Bei Gasheizungen gestaltet sich die Lage anders. Der Marktführer Truma hat mittlerweile entschieden, nur noch Geräte mit 30 Millibar herzustellen. Ein Defekt der alten Heizung kann daher bedeuten, dass die gesamte Anlage umgerüstet werden muss.
Welchen Druck der Regler liefert, lässt sich an der Farbe erkennen. 50-Millibar-Ausführungen sind orange und 30-Millibar-Modelle gelb gekennzeichnet. Druckregler sind Verschleißteile und müssen alle sechs Jahre getauscht werden.
Nicht jeder Regler ist für den Bordgebrauch geeignet. Nur Ausführungen, die nach G 608 zugelassen sind, bieten Korrosionsschutz innen und außen. Günstigere Modelle aus dem Campingbereich überstehen das aggressive Seeklima nicht lange. Ein Regler sollte zudem ein Manometer haben. Damit kann man zwar nicht genau messen, wie viel Gas noch in der Flasche ist, aber die Dichtigkeit der Anlage lässt sich überprüfen: Einfach nach dem Kochen das Flaschenventil zudrehen und den Zeigerstand markieren. Solange sich die Temperatur nicht stark verändert, sollte der Zeiger auch nach einigen Stunden unverändert bleiben. Sinkt jedoch der Druck, gibt es ein Leck, und ein Fachmann sollte hinzugezogen werden.
Gasleitungen
Damit das Gas aus der Flasche zum Verbraucher gelangt, müssen Leitungen installiert werden. Rohrleitungen sind stabil und erfordern wenig Wartung. Gemäß den Vorgaben des Arbeitsblatts G 608 sind Edelstahl- oder Kupferrohre erlaubt. Stahl, wie er in Wohnwagen häufig genutzt wird, ist inzwischen verboten. In der Regel werden Kupferrohre mit einem Durchmesser von acht Millimetern genutzt, da sie sich leicht biegen und einfach verlegen lassen.
Weil das Material bei jeder Verformung spröder wird und die Bruchgefahr steigt, sollte das Rohr beim Verlegen so wenig wie möglich gebogen werden. Um Brüche durch Vibrationen zu vermeiden, muss die Leitung alle 50 Zentimeter mit einer Schelle gesichert werden. An den Schotten kann entweder eine Verschraubung verwendet oder ein so großer Ausschnitt ins Holz gesägt werden, dass das Rohr nicht reibt.
Für Kupplungselemente verwendet man Schneidringverschraubungen. Diese metallenen Verbinder sind einfach selbst zu montieren und lassen sich leicht wieder öffnen. Eine solche Installation kommt nicht ohne Schläuche aus, da die Gasflasche gewechselt werden muss und ein kardanisch aufgehängter Herd frei schwingen soll. Daher ist im Flaschenkasten und am Herdanschluss ein 40 Zentimeter langer Mitteldruckschlauch zulässig. Mit so kurzen Schläuchen funktionieren kardanische Kocher oft nicht richtig. Im Rahmen des Bestandsschutzes sind deshalb auch längere Schläuche erlaubt. Diese sind jedoch nur über Fachleute erhältlich, da normale Schiffsausrüster meist nur Standardlängen im Angebot haben.
Jeder Verbraucher muss über ein Schnellschlussventil verfügen, das eine Trennung von der restlichen Anlage ermöglicht. Dies funktioniert nur, wenn es im Betrieb leicht zugänglich ist. Es kann daher nicht, wie oft auf skandinavischen Schiffen, hinter dem Herd eingebaut sein, da im Notfall die Flammen eines außer Kontrolle geratenen Kochers eine Abschaltung verhindern könnten. Wenn sich der Absperrhahn in einem Schrank befindet, sollte ein entsprechender Aufkleber darauf hinweisen.
Auch wenn die Ventile häufig genutzt werden, halten sie in der Regel ein ganzes Schiffsleben. Solange kein Gas benötigt wird, sollte das Flaschenventil stets geschlossen bleiben, um bei einem Leck ein Ausströmen von Gas zu verhindern. In der Praxis sieht das jedoch oft anders aus: Um wertvollen Stauraum zu sparen, wird die Gasflasche gewöhnlich in die hinterste Ecke gestellt. Das führt dazu, dass das Entnahmeventil weit entfernt ist. Wer kriecht schon nach dem Abendessen noch im Cockpit herum, um die Flasche zu schließen, besonders wenn sie am nächsten Morgen für den Kaffee wieder geöffnet werden muss?
Bequeme elektrische Gasfernschalter bieten eine Lösung für dieses Problem, sind jedoch auf Booten mittlerweile nicht mehr erlaubt. Alte Installationen genießen jedoch Bestandsschutz. Ein Gaswarner sorgt für zusätzliche Sicherheit. Obwohl Propan und Butan mit einem charakteristischen Duftstoff versetzt werden, kann dieser leicht von anderen Gerüchen überlagert werden. Außerdem muss das Gas im Salon nicht unbedingt bemerkbar sein, besonders wenn es sich zuerst in der Bilge ansammelt. Ein Gaswarner reagiert auch in solchen Fällen zuverlässig. Diese elektronischen Detektoren kosten je nach Modell zwischen 30 und 150 Euro.
Prüfung der Anlage
Wenn alle Teile der Anlage für den Einsatz auf Wasserfahrzeugen zugelassen sind, sollte der Abnahme durch einen Sachverständigen nichts entgegenstehen. Dazu gehört unter anderem eine Dichtigkeitsprüfung. Dafür wird anstelle des Druckreglers eine Luftpumpe mit Manometer angeschlossen, um einen Überdruck von 150 Millibar auf die Anlage aufzubringen. Nach fünf Minuten muss der angezeigte Druck weitere fünf Minuten konstant bleiben. Diese Prüfung ist empfindlicher als die Suche mit Leckspray und deckt auch kleinste Undichtigkeiten auf.
Nach der Dichtigkeitsprüfung werden alle Verbraucher durch eine Brennprobe überprüft und die Zündsicherungen kontrolliert. Zwischen dem Erlöschen der Flamme und dem Abschalten der Sicherung dürfen höchstens 60 Sekunden verstreichen. Bei Gasherden erkennt man das Abschalten dieser Sicherung durch ein Klickgeräusch.
Werden alle Kriterien erfüllt, erfolgt der Eintrag ins Gasbuch. Dieses blaue Heftchen gehört zu jeder Gasanlage. Wer es trotz Prüfplakette am Gaskasten nicht hat, sollte beim Prüfer nachfragen oder einen anderen Sachverständigen konsultieren. Die Abnahme der Anlage kostet etwa 60 Euro.
Immer die richtige Flasche
Ob klein oder groß, blau oder grau, aus Stahl, Aluminium oder Kunststoff – auf den ersten Blick gibt es eine Vielzahl von Gasbehältern zur Auswahl. Das gilt jedoch nur, solange die Reise ausschließlich durch Deutschland führt oder das mitgebrachte Gas für die gesamte Strecke ausreicht. Abhängig von den Platzverhältnissen kann der Skipper zwischen Butan gefüllten Campingaz-Flaschen mit 1,8 und 2,75 Kilogramm oder Propangasflaschen in den Größen 2, 3, 5 oder 11 Kilogramm wählen. Hinzu kommen die leichten 6- und 11-Kilo-Alugas-Flaschen sowie Kunststoffflaschen mit 2 und 5 Kilogramm Füllung.
Ein Blick auf die Preise lässt Käufer schnell an den grauen Propangasflaschen Gefallen finden. Auch wenn es sich um Eigentumsbehälter handelt, sind sowohl Tausch als auch Füllen möglich, und das Gas kostet nur etwa 13 bis 17 Euro für 5 Kilogramm. Bei den selteneren 2- oder 3-Kilogramm-Formaten gibt es nur wenige Tauschstationen, aber das Befüllen ist deutschlandweit möglich.
Kunststoffflaschen müssen meist gefüllt werden. Sie punkten durch ihr geringes Gewicht, Rostfreiheit und die Möglichkeit, die Gasmenge von außen zu sehen, aber es fehlt eine Prüf-Infrastruktur. Die Druckbehälter müssen alle zehn Jahre abgenommen werden. Bei Stahlflaschen wird diese TÜV-Abnahme von der Füllstelle organisiert und kostet etwa 15 Euro. Einige Betriebe erledigen die Prüfung für Stammkunden kostenlos oder berechnen bei jeder Füllung eine anteilige Gebühr. Kunststoffflaschen müssen jedoch extra zum Hersteller geschickt werden.
Bleiben noch die von vielen Werften vorgesehenen blauen Campingaz-Flaschen. Diese sind teuer: Eine Füllung kostet zwischen 30 und 40 Euro für 2,75 Kilogramm Gas. Vorteilhaft ist allerdings die weltweite Versorgungssicherheit laut Hersteller. Zumindest in Europa stimmt diese Aussage weitgehend, auch wenn es in Skandinavien, insbesondere Norwegen und Schweden, Einschränkungen gibt – man kann die Flaschen nicht überall tauschen. Zudem sind sie dort oft doppelt so teuer wie bei uns. Wer von einer EU-Norm für Gasflaschen und -anschlüsse ausgeht, wird enttäuscht.
Bei anderen Formaten stellen Auslandsreisen tatsächlich ein Problem dar. Obwohl die Behälter äußerlich ähnlich sind, hat jedes Land immer noch seine eigene Norm für Anschlüsse. In der Praxis bedeutet das: Wer mit einer der in Deutschland gängigen grauen Propangasflaschen reist, könnte bereits in Dänemark Schwierigkeiten bekommen, wenn die Flasche leer ist.
Der in Deutschland übliche Tausch ist nicht möglich, es bleibt nur das Nachfüllen. Dafür gibt es im Zubehörhandel sogenannte Euro-Adaptersätze. Füllstationen sind jedoch seltener als Tauschstationen und oft nicht in der Nähe von Marinas. Man ist zudem auf das Wohlwollen des Abfüllers angewiesen, da in vielen Ländern nur Flaschen nach nationaler Norm gefüllt werden dürfen. Es besteht daher die Gefahr, dass die Flasche leer bleibt.
Online-Campingseiten wie reisemobil-international.de bieten Einblicke zum Gasnachschub im Ausland. Diese enthalten jedoch nur Erfahrungsberichte, wodurch ein gewisses Restrisiko bleibt.