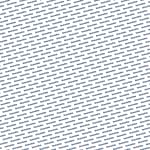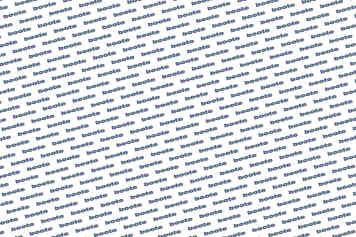Jeder kennt IKEA-Möbel. Jeder hat sie zu Hause. Die Marke wächst und expandiert. Insgesamt 433 Kaufhäuser gibt es mittlerweile weltweit, und jedes Jahr kommen rund ein Dutzend dazu. Früher war es die Freiheitsstatue, die Reisende in die Neue Welt zuerst erblickten – heute ist es der gelb-blaue IKEA in Brooklyn … Der Schwede Joacim Gustavsson hat viele Jahre begehrte und sogar prämierte Möbel für das größte Möbelhaus der Welt konstruiert und designt. Sein Stuhl „Nordmyra“ steht sogar im IKEA-Museum und ist immer wieder beliebtes Requisit in amerikanischen Filmen. Dennoch hat Gustavsson seine angesehene Anstellung dort aufgegeben – um Boote zu konstruieren.
BOOTE: Herr Gustavsson, warum hat es Sie als Designer einer weltweiten Großserie zu solch einer kleinen Nobelmarke wie Nimbus gezogen?
Joacim Gustavsson: Ich hatte schon immer eine innige Beziehung zum Meer. Gleich nach dem Schulabschluss habe ich deshalb auch erst mal eine Lehre zum Holzbootsbauer gemacht. Mein Vater konnte das damals absolut nicht verstehen, denn das hatte es bei uns in der Familie noch nie gegeben. Niemand hatte etwas mit Booten zu tun. Aber ich wollte unbedingt lernen, wie man traditionell Boote baut. Damals war ich 15 Jahre alt.
Warum sind Sie dann nicht beim Bootsbau geblieben?
Als ich 1991 die Lehre beendet habe, war gerade eine schlechte Zeit für Bootsbauer. Boote verkauften sich nicht sonderlich gut. Ich habe mich damals sogar bei Nimbus beworben, aber sie hatten keine offenen Stellen und eine zu geringe Auslastung, um einen weiteren Bootsbauer einzustellen.
Also mussten Sie für sich einen neuen Weg finden ...
Genau, ich habe mich umorientiert. Das Arbeiten an Werkstoffen fand ich spannend, wollte aber nicht selbst den Hobel schwingen. Also bin ich zur Uni gegangen und habe meinen Master in Innenarchitektur gemacht. So bin ich im Möbeldesign und bei IKEA gelandet, als freiberuflicher Designer.
Das muss eine ziemlich spannende Aufgabe gewesen sein.
Es war wirklich eine aufregende Zeit, denn IKEA hat ein ganz interessantes Arbeitsklima. Die Firma steckt voller Energie und Kreativität, und man hat keine Angst, mal etwas ungewöhnliches auszuprobieren. Ich habe viel über Perfektion gelernt, aber auch über betriebswirtschaftliches Denken. Und was es heißt, eine Modellreihe zu entwickeln. Viele Felder, mit denen man für gewöhnlich als Designer keine Berührungspunkte hat. Ich wollte schon immer eine kreative Person sein, und IKEA hat dazu beigetragen, mich dazu zu entwickeln. Eine Schule fürs Leben.
Inwiefern hat Sie die Zeit bei IKEA geprägt?
Bei IKEA ist man nicht nur Designer, sondern zugleich Projektleiter. Man managt das gesamte Projekt, das einem aufgetragen ist, vom Konzept bis zur Produktion. Zunächst wird ein Plan erstellt, was das Produkt kosten darf. Außerdem, wie die Modellreihe aufgestellt ist und wo das Produkt am kostengünstigsten gebaut werden kann. Das ganze Geschäftsmodell hinter dem Möbelstück ist mit die Aufgabe des Projektleiters. Das war eine gute Lehre, wie der ganze Hintergrund abläuft. Von meiner Idee bis zum fertigen Produkt, das im Laden steht.
Und trotzdem zog es Sie zurück ans Wasser und zu den Booten.
Ja, nach einigen Jahren mitten im Binnenland musste ich einfach wieder zurück an die Küste und nach Göteborg. Dort habe ich 2007 bei Nimbus angefangen und war zunächst zuständig für das Innendesign. Im Jahr 2008 ging eine neue Krise los. Ein blödes Timing für mich – anzufangen, wenn alles bergab geht.
Aber es ging auch wieder bergauf?
2012 hat Nimbus einen neuen Eigentümer bekommen, und das sah ich als Chance, etwas mehr Verantwortung im Designprozess zu bekommen. Ich wollte mich auch um das Außendesign kümmern. Mittlerweile sitze ich als Designer mit im Management der Werft und verantworte mit einem Kollegen das Gesamtbild der Nimbus-Reihe.
Verglichen mit IKEA handelt es sich bei Nimbus ja eher um einen kleineren Betrieb …
... Und das hat Vorteile: Alles geht schneller und direkter. Wir arbeiten in einem kleinen Team, was sehr effizient ist. Vor allem, wenn man als Designer selbst im Management ist und selbst Einfluss auf Änderungen in Produktion und Budget ausüben kann. Anders, als wenn man in einer großen Firma immer mit Fragen und Vorschlägen zum Management kommen und sie absegnen lassen muss. Das ist der Grund, weshalb wir die gesamte Flotte in kurzer Zeit überarbeiten konnten. Wir haben in zweieinhalb Jahren acht neue Modelle auf den Markt gebracht.
Die Boote sehen nicht aus, als würden sie von IKEA stammen.
Nein, die Zielgruppe ist ja eine vollkommen andere! Das ist auch die erste Regel: rauszufinden, wie die Zielgruppe aussieht. Das Design muss auf jeden optisch schick und gefällig wirken, aber auch clever auf die jeweilige Kundengruppe zugeschnitten sein. Bei IKEA handelte es sich immer um moderne und günstige Alltagsgegenstände. Nimbus hingegen ist eine hochklassige Marke. Trotzdem ist die Herangehensweise ähnlich: Man versucht zunächst den Kunden zu analysieren.
Es gibt also Parallelen zu IKEA?
Die Philosophie von Nimbus ist tatsächlich ähnlich der von IKEA: Wir bauen sehr demokratisch. Wir wollen kein Luxusprodukt. Ein qualitativ hochwertiges Premiumprodukt zwar – aber die Fischer sollen unser Boot genauso mögen wie die Familie. Auch der erfahrene Seemann soll beeindruckt und zufrieden sein. Das ist unser Maßstab. Die Optik folgt dabei manchmal dem Zweck.
Wie sieht Ihr normaler Tagesablauf aus?
Meine Aufgabe ist es, mich um die Lösung von Problemen zu kümmern, die in der Entwicklung auftauchen. Wenn ich nun nach Hause komme, müssen wir zum Beispiel das Dach neu entwerfen, weil wir einige Probleme damit hatten und jetzt einen neuen Lösungsansatz gefunden haben. Der Tag besteht also aus vielen kleinen Besprechungen mit Teammitgliedern. Ich schaue ihnen über die Schulter, oder sie kommen zu mir und fragen, ob ihre Arbeit so in Ordnung ist. Ich bin jeden Tag Teil eines Teams. Es ist nicht so, dass ich allein auf einem Felsen sitze und über gutes Design sinniere.
Wie läuft so ein Entwicklungsprozess ab?
Auch das ist tatsächlich ähnlich wie bei IKEA: Man hat ja meist schon ein vorhandenes Sortiment, ob Stühle oder Boote. Die schauen wir uns an und fragen uns: Ist das aus heutiger Sicht noch gut? Passt es noch in die heutige Zeit, was Leistung, Ausstattung, Platzangebot und Mode angeht? Gibt es neue Ideen oder neue Lösungen für die Anforderungen? Und wie sieht es betriebswirtschaftlich aus, verdienen wir mit dem Produkt noch Geld? Nicht immer muss ein Modell auch Geld einfahren, indem es sich verkauft – manchmal ist ein Modell lediglich eine gute Vervollständigung der Reihe, und man verkauft mit dem kleinen Boot im Repertoire viel mehr größere Boote. Der Designprozess eines neuen Boots beginnt also immer damit, erst mal die vorhandene Palette zu analysieren.
Wie geht es dann weiter?
Wir überlegen dann, ob überhaupt ein neues Design hermuss, oder ob ein Facelift nicht ausreicht. Die durchschnittliche Lebensspanne eines Boots bei Nimbus sind acht Jahre. Nach fünf Jahren versuchen wir bereits ein Facelift zu machen. Diese Intervalle stammen aus Statistiken, wie lange sich die Boote gut verkaufen. Es gibt für jedes Modell zudem ein bestimmtes Budget, das wir ausgeben können, um die Boote immer modern und frisch zu halten.
Angenommen, es muss ein neues Modell her. Wie gehen Sie an das Design heran?
Es beginnt selten mit einem Modell, meist mit dem Plan der ganzen Baureihe. Wir schauen uns die Reihe an und überlegen, was wir tun müssen, um sie effizient zu halten. Dabei erkennen wir dann manchmal, dass ein Boot nicht mehr ganz dem Standard entspricht und überarbeitet werden muss. Aus dieser Lücke in der Reihe gehen dann natürlich Länge, Breite, Volumen usw. hervor. Es entsteht zunächst eine grobe Studie, wie das neue Boot aussehen soll. Dann erst beginnen wir mit dem Zeichnen. Manche Designer nehmen auch einfach den Stift in die Hand und schwingen ihn kreativ über ein weißes Papier. Oft merkt man dann aber erst am Ende, dass das Boot zwar nett aussieht, aber gar nicht in die Vorgaben passt. Also setze ich mir auf dem Computer klare Eckpunkte und zeichne dort hinein.
Das Boot entwerfen Sie dann ganz allein?
Nein, ganz und gar nicht. Wenn die Grundstruktur steht, beginnt das Designteam früh damit, sich um Detaillösungen zu kümmern, etwa das Bugstrahlruder oder die Fensterscheiben. Dabei kommen sie immer wieder zu mir und fragen: „Ist das in etwa so, wie du dir das vorgestellt hast?“ Ich selbst kümmere mich um manche Sachen mehr, um manche weniger. Das Armaturenbrett zum Beispiel ist mir immer wichtig, da versuche ich viele gute Detaillösungen zu erarbeiten. Aber wie ich sagte: Das Design ist sehr demokratisch. Das Team entwickelt es zusammen, nicht nur ich allein. Ich entwickle zwar das Konzept und habe dann den Hut auf, was Entscheidungen angeht, aber wir entwickeln das Boot zusammen.
Wie können wir uns das Team vorstellen?
Es besteht aus acht bis zehn Leuten, fast alles Spezialisten für bestimmte Gebiete. Wir haben einen Spezialisten für den Rumpf, der alle Berechnungen durchführt, dann einen Elektroniker, einer kümmert sich um die CAD-Files, die wir an die Fabrik schicken, die die Holzteile fräst. Einige arbeiten ständig am Boot, andere nur, bis ihr Spezialfeld abgeschlossen ist.
Wie lang dauert die Entwicklung? Mehrere Jahre?
Von der Idee bis zum fertigen Boot dauert es 13 bis 15 Monate. Wir sind ziemlich schnell, vor allem verglichen zum Automobilbau. Beim Autobau gibt es ja viele Prototypen und Entwicklungsstufen, dann Crashtests, die die Entwicklung einbremsen oder umwerfen, bis am Ende ein Auto serienreif ist. Im Bootsbau fällt das alles weg. Da heißt es einfach: Los geht’s!
Haben Sie etwas aus dem Möbelbau mitgenommen?
Ich denke, mein Gefühl für dreidimensionales Denken und Ergonomie. Alles muss nicht nur hübsch, sondern auch bequem sein. Stilistisch fällt mir nichts ein. Vielleicht die Funktionalität, denn es geht auf einem Boot ja immer darum, den geringen Platz möglichst gut und funktional zu nutzen. Aber was ausgefallene Lösungen angeht, ist Nimbus eher traditionell. Wenn wir da mutiger wären, könnte ich mehr von meiner Erfahrung bei IKEA einbringen. Aber bei einer Nobelmarke können wir natürlich nicht allzu verrückt sein.
Das war bei IKEA sicher einfacher ...
Ja, die Grenzen waren dort sehr weit gesteckt. Wir konnten uns designmäßig so richtig austoben.
Dieser Artikel erschien in der BOOTE-Ausgabe 07/202o und wurde von der Redaktion im Dezember 2023 überarbeitet.