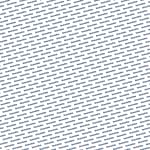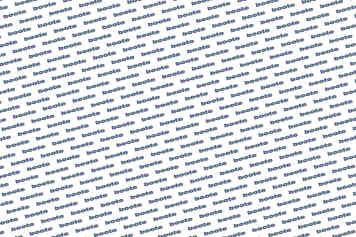- Containerfrachter gleicht nicht Traumschiff
- An Schlaf ist vor Aufregung kaum zu denken
- Einmal um den Containerfrachter sind es 17 Minuten
- Ein Containerfrachter ist kein Freizeitpark
- Nach „Feierabend“ bin ich auf der Kommandobrücke vom Containerfrachter zu finden
- Nach zwölf Tagen Atlantik kommt Südamerika in Sicht
- Tausche Containerfrachter gegen Hotelzimmer
- Am Ende trage ich mein Schiff auf dem Arm
- Das Schiff
- Die Reederei
- Die Person
- Das Projekt
Text von Phillip Gätz
Die Autobahn windet sich aus dem Elbtunnel hinaus, mitten hinein in den Hamburger Hafen. Hier schlägt sein Herz, auch heute im Starkregen. Rechts die Ausfahrt nach Waltershof. Unser Ziel ist das Eurogate Terminal mit seiner Skyline aus Verladebrücken. Hoch aufgetürmte Container bilden eigene Straßenschluchten, eine Stadt in der Stadt. Dahinter ragt eine rote Wand auf: das Schiff. „Ist die riesig“, sage ich nur und fühle gewaltigen Respekt. Noch nie habe ich etwas so Großes und Eindrucksvolles aus der Nähe gesehen wie die „Cap San Marco“, 333 Meter lang, der Containerfrachter, einer der Giganten in der Flotte der Hamburg Süd.
Nach der Vorlage aller notwendigen Papiere – und das sind viele – geht es per Shuttlebus zur Gangway. In zig Taschen habe ich 50 Kilo Foto-Equipment für meine Aufgabe und dazu Klamotten für alle Fälle dabei – schließlich werde ich in vier Wochen fast vier Jahreszeiten erleben. Jetzt fehlen nur noch 72 steile Stufen. Hilfe wird mir angeboten, doch ich will es allein schaffen. Oben angekommen, zittern die Knie, auch vor Aufregung. Jetzt, im September 2019, geht nach sieben langen Monaten voller Kampf und Krampf für die Erfüllung dieses Traums plötzlich alles so schnell, vielleicht zu schnell.
Containerfrachter gleicht nicht Traumschiff
Ein wachhabender Kadett springt herbei: „Sir, let me help. Are you visiting?“ Ich stehe noch neben mir und nicke nur. Doch meine Begleiter passen besser auf: „Nein, der bleibt an Bord. Er fährt mit.“ Freude ringsum: Ein neues Gesicht auf einem monatelangen Törn ist immer gern gesehen. Ich kann die Eindrücke noch gar nicht greifen, da nimmt mir ein anderes Besatzungsmitglied meine Taschen ab und verfrachtet sie drei Schotts weiter in einen Fahrstuhl, dazu mich und meine Entourage von der Hamburg Süd. Ich glaube mich im Aufbau zu befinden. „Hallo“, sagt mein Helfer jetzt, „ich bin Holger, wir bringen dich mal auf Station.“ Es wird ein Schlüsselmoment, denn Holger, dessen Overall schwere Arbeitsspuren trägt und amtlich nach Öl riecht, ist nicht nur unwesentlich jünger als ich, sondern auch Zweiter Offizier.
Ich habe als Kind mit meinen Großeltern wohl zu viel „Traumschiff“ gesehen und war sicher, dass eine weiße Sascha-Hehn-Gedächtnis-Uniform bei solcher Dienststellung Pflicht ist, immer. Ich erhalte die Eignerkabine. Von Anfang bis Ende der Reise in Südamerika. Genau genommen lautet das Ziel Buenos Aires, Argentinien. Die Kabine ist frei, kein Eigner in Sicht. Eine Unterkunft, so weiträumig wie eine Hotelsuite im Las Vegas der wilden Neunziger. Nur: kein Luxus hier, eher zweckmäßiger Charme. Fehlen nur noch Siegfried und Roy für die große Show. Die beiden lerne ich aber später kennen, in Person des Kapitäns und des Chefingenieurs, sowie alle übrigen „Macher“ meiner Traumwerkstatt.
An Schlaf ist vor Aufregung kaum zu denken
Das Schiff ist groß, unfassbar groß. Einen Tag werde ich herumgeführt, als Teil der Sicherheitseinweisung und (gefühlt) eintausend weiterer relevanter Protokolle, abgenommen von der Dritten Offizierin. Paulina kommt aus Polen: „Warst du schon mal auf einem Containerfrachter?“, fragt sie auf Englisch, der Bordsprache. „Na ja“, antworte ich, „eher auf kleineren Schiffen, Sportbooten eben, meist so fünf bis acht Meter lang.“ Sie lacht. 48 Stunden liegt die „Cap San Marco“ in Hamburg, Zeit für erste, vorsichtige Erkundungen. Solche Schiffe und das riesige Terminal kenne ich nur aus dem Fernsehen. Alles ist groß, laut und brachial, Tag und Nacht. Ich beobachte am Ende des Tages von meiner Kabine noch stundenlang das Geschehen draußen. „Die Sendung mit der Maus“ wird wahr.
Beim Aufwachen halte ich die Kamera sogar noch in der Hand. Als ich beim Frühstück in der Offiziersmesse in einer Runde von etwa zwölf hochrangigen Personen unserem „Alten“ vorgestellt werde, sieht man mir an, dass ich kaum geschlafen habe. Die Ratings, also die unteren Ränge, speisen in einer eigenen Messe mit eher asiatisch geprägter Küche. Es sind Leute aus zig Nationen, freundlich, hilfsbereit und offen. Nicht zuletzt ein Resultat respektvoller Gleichbehandlung abseits der nötigen Dienstgrad-Hierarchie, wie ich im Laufe der Fahrt feststelle. Die Küche der Offiziere ist eher europäisch ausgerichtete. Wer Lust hat, kann beide Welten zumindest kulinarisch vereinen. Später wird es einmal eine Nacht auf See geben, in der ich selbst die immer zugängliche Kombüse aufgesucht, den Sandwichtoaster hervorgekramt und zur allgemeinen Begeisterung für die gesamte Brückenwache aufgetischt habe.
Einmal um den Containerfrachter sind es 17 Minuten
Als ich noch in Hamburg die Zeit habe, mich mit dem Schiff vertraut zu machen, verankert sich bei mir der Gedanke: „Du kannst die Größe nicht greifen.“ Ich muss immer wieder auf die Brücke, ans Heck, an den Bug und bis tief in die Laderäume, damit mein Gehirn sich ein Gesamtbild der Dimensionen machen kann. Man geht fast acht Minuten (auf einem Schiff wird nicht gerannt!) von einem Ende zum anderen. Einmal rundum sind es 17 Minuten. Hätte man einen Hund, wäre das völlig ausreichend. Die Größe der Crew ist mit knapp unter dreißig Personen dagegen überschaubar. Schon vor dem Auslaufen habe ich sie bereits komplett kennengelernt. Die gesamte Crew, also auch Kapitän und Offiziere, sind relativ jung. Das Durchschnittsalter liegt bei gerade einmal 35 Jahren. Das ist natürlich eine super Basis. Und man zeigt auch für mein Projekt, das Leben an Bord fotografisch einzufangen, Interesse. Mal etwas anderes.
Kurz vor dem Ablegen werde nicht nur ich nervös. Plötzlich wird es bei allen hektisch – wie bei einer Familie, die endlich mit dem Multivan in den mehrwöchigen Urlaub starten will. Haben wir wirklich alles? Na dann los! Wie in einer richtigen Schmonzette reißen minutengenau die Wolken auf. Die Sonne strahlt, sogar ein Regenbogen steht über der Stadt. Wer noch nie, wie ich als Zugezogener, die Elbe stromabwärts Richtung Nordsee gefahren ist, der ist von dem Szenario mehr als ergriffen. Wahnsinn, wie das Schiff ablegt, während ich dem Spektakel mit den Schleppern auf der Brücke beiwohnen darf. Mein „Hotel“ bewegt sich plötzlich. Erst langsam, dann schneller. Blankenese und das Airbus-Werk ziehen aus vierzig Meter Höhe vorbei, Menschen winken, und mir wird klar: Schon Millionen von Seeleuten ist es über Jahrhunderte hier genauso ergangen: Wir verlassen die Heimat – auf ins Ungewisse!
Ein Containerfrachter ist kein Freizeitpark
Die ersten Tage auf See. Es geht vorbei an europäischen Häfen wie Antwerpen und Le Havre. Ich sauge die Stimmung und die Erlebnisse nur so auf, werde vertraut mit der Crew. Ich werde Teil der Mannschaft, lerne sie und ihre Lebensweise auf dem Schiff kennen – irgendwo zwischen An- und Ablegemanövern, Löschen, Schicht, Fitnessraum, Messe, Karaoke, Sauna, Pool oder an der Tischtennisplatte. Dabei handelt es sich bei dem Containerfrachter „Cap San Marco“ natürlich nicht um einen Freizeitpark: Wenn es viele Annehmlichkeiten für die Crew gibt, darf man nicht vergessen, dass diese Frauen und Männer teils Monate fernab der Heimat, ohne die Familie und ohne ein richtiges Wochenende oder Abstand zum Arbeitsplatz harter Arbeit nachgehen, ohne die Möglichkeit zum spontanen Kurzurlaub.
Ich führe Tagebuch, auch in den sozialen Medien. Noch. Ich lerne viel, ich sehe viel und entwickle schon in den ersten von insgesamt 30 Tagen auf diesem Schiff eine Liebe: die zur Brücke. Ich habe schnell das uneingeschränkte Vertrauen, mich auf dem Schiff allein zu bewegen. So auch jederzeit auf der Brücke. Ich steige langsam durch den Wach- und Wechselrhythmus durch, jeder Posten ist redundant besetzt, außer meinem, und trotzdem ist mir Schlaf nahezu egal, die gesamte Fahrt über. Dieses Schiff schläft ja auch nie. Die Eindrücke wollen nicht abreißen, dabei haben wir nicht mal Europa hinter uns.
Nach „Feierabend“ bin ich auf der Kommandobrücke vom Containerfrachter zu finden
Mich findet man mittlerweile meist ab Mitternacht, nach meinem fotografischen „Feierabend“, auf der Brücke, wo ich stundenlang mit dem Zweiten Offizier Holger sitze und er mir alles über das Schiff und das Business erzählt. Er wird mein Mann der Fahrt. Wir schlagen uns die Nächte um die Ohren, und ich sitze auf dem Co-Piloten-Sitz, ähnlich wie im Flugzeug. Wer glaubt, das sei langweilig oder eintönig, der irrt: Allein der Sternenhimmel ist unbezahlbar. Gegen vier Uhr endet „unsere“ Schicht, ich schlafe bis acht Uhr, dann kommt das Frühstück und um zwölf Uhr mittags treffen wir uns wieder auf der Brücke – weil ich dann das Horn betätigen darf. Einer der vielen technischen Routinetests an Bord.
Bei der Ansteuerung des französischen Hafens von Le Havre am Ärmelkanal macht das Wetter dem Lotsenboot einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen wird ein Helikopter eingesetzt. Für die Crew ist das nichts Besonderes, für mich aber der Wahnsinn. Mitten in der Nacht setzt der versierte Pilot den Lotsen auf unserer Brückennock per Winsch ab – Zentimeterarbeit. Von diesem einen Tag abgesehen hatten wir auf der ganzen Reise aber weitgehend Wetterglück – es hat zwar manchmal ordentlich gerollt und ein wenig gestürmt, aber alles in allem war der Seegang lau. Andererseits kann ein 300-Meter-Schiff natürlich auch mehr ab als ein Motorboot. Die Crew meinte trotzdem nur: „Sei froh.“ Froh war man wohl auch deshalb, weil die Landratte nicht seekrank wurde und so die Krankenstation nur fotografisch dokumentiert wurde.
Nach zwölf Tagen Atlantik kommt Südamerika in Sicht
Unser Kurs führt südwärts: durch die Biskaya, vorbei an Portugal. Es wird wärmer. Dem deutschen Herbst kehren wir den Rücken. Es ist fast, als käme der Sommer wieder. Nach einem letzten Stopp in Südspanien passieren wir die eindrucksvolle Straße von Gibraltar. Und dann ist es so weit: Die Atlantikquerung steht an, zwölf Tage nichts und niemand, auch keine sozialen Medien. Fast 38 Grad Außentemperatur am Äquator. Ich beschließe, mit Erlaubnis der Schiffsführung, unseren bordeigenen Indoor-Pool mit Meer-wasser zu fluten und das Netz der Tischtennisplatte zu reparieren. Die Truppe ist begeistert.
Die Seetage an Bord vom Containerfrachter verstreichen mit Übungen (wie Feueralarm oder Mann über Bord), stets bestem Essen, ausgiebigen Besuchen im heißen Maschinenraum, der einem in Form und Größe über mehrere Decks den Atem stocken lässt. Dazu kommen fantastische Sonnenauf- und -untergänge, vorbeiziehende Walfamilien, Delfine und passierende Containerfrachter aus aller Herren Länder. Halbzeit. Auf Höhe des Äquators gibt es wie immer eine Party, ein großes Grillfest. Alkohol gibt es nicht an Bord, 0,0 Prozent. Ein Problem ist das nicht.
Und dann: Land in Sicht: Brasilien. Nach zwölf Tagen sind wir in Santos, der vorgelagerten Hafenstadt des Ballungsraums São Paulo – seltsam, plötzlich wieder Vögel zu sehen und dann auf Tuchfühlung mit einem Kontinent zu gehen, den ich vorher und vor allem so entschleunigt noch nie erreicht habe. Zum ersten Landgang darf ich unter Auflagen auch mit. Fünf Unterschriften und drei Passkontrollen später sitze ich mit dem Kapitän und einigen Offizieren in einer brasilianischen Strandbar mit einer live vom Baum gekappten, alkoholfreien Kokosnuss. Danach ins landestypische Steakhaus. Was für eine Ankunft.
Tausche Containerfrachter gegen Hotelzimmer
In den nächsten zwei Wochen, der zweiten Reisehälfte, läuft Containerfrachter „Cap San Marco“ noch eine Reihe weiterer brasilianischer Häfen an, bevor es nach Montevideo in Uruguay geht. Dann Buenos Aires, Hauptstadt Argentiniens. Voller Wehmut verbringe ich die letzten 48 Stunden zusammen mit „meinen Jungs“, die meine Gefühlslage nicht nur wahrnehmen, sondern teilen, ehe es adios heißt. Der Schein der Skyline von Buenos Aires wird um vier Uhr nachts sichtbar, es wird Zeit zu packen. Frühmorgens, nach wenig Schlaf, trage ich mich aus dem Logbuch aus und darf am Whiteboard, dem Brett, auf dem eigentlich nur der Kapitän und obere Offiziere Einträge vornehmen dürfen, eine Abschiedsbotschaft für alle hinterlassen – unter den Augen mancher Crewmitglieder.
Wir sind alle am Wasser gebaut. Schnell geht es runter vom Schiff. Zum Abschied umarme ich Kapitän und Offiziere – als wir uns zu Reisebeginn kennenlernten, wäre das schon allein aus dienstlichem Respekt völlig undenkbar gewesen. Jetzt ist es gerade der Respekt, der Nähe geschaffen hat. Dann kehrt die Führungsriege an Bord zurück, und ich verbringe meine erste Nacht im Hotel, erstmals seit Wochen ganz allein auf der anderen Seite der Erde... Frisch an Land, empfinde ich das Hotelzimmer und das Leben und die Geräusche der Großstadt erst einmal sehr beengend. Aber spannend. Mit einem ersten Dosenbier auf dem Nachttisch versuche ich alles für den Moment sacken zu lassen. Doch das Bier schmeckt nicht recht, auch nach mehr als vier Wochen nicht, nicht allein. Ich möchte heim, auf meinen Containerfrachter ...
Am Ende trage ich mein Schiff auf dem Arm
Von einer Anglerpier kann ich die Ausfahrt der „Cap San Marco“ am nächsten Morgen zumindest noch begleiten. Was dann passiert, überwältigt mich: Obwohl ich winzig wirke neben dem gewaltigen Schiff, erspäht mich der Kapitän tatsächlich mit dem Fernglas und lässt nur für mich das Horn ertönen. Sein tiefer Ton reicht bis an die Tränendrüsen. Ich fühle mich immens geehrt, denn ich weiß: So ein Signal ist hier eigentlich nicht erlaubt. Später weiß ich: Der Kapitän hatte diese besondere Ausnahme bei der Port Authority erbeten. Doch es geht noch weiter: Danach rennen alle Crewmitglieder, die nicht auf Manöverstationen sind, an Deck, winken, schreien und brüllen.
Ein letztes Geleit. Denn während ich gerade mein Schiff verliere, müssen die anderen drüben jetzt ohne ihren „First Photo Officer“, wie sie mich am Äquator getauft haben, auskommen. Ein sehr emotionaler Moment. Tränen ja, Trauer nein. Dafür war das Erlebnis zu großartig. Ich bleibe noch lange auf der Pier, doch irgendwann ist selbst die riesige „Cap San Marco“ so weit entfernt, dass sie kaum noch auszumachen ist. Dann drehe ich mich um, hin zu der Millionenmetropole, die mir nun noch eine Woche lang Appetit auf Neues machen soll. Aber selbst dem schönsten Nachtisch fällt das nach einem sensationellen Hauptgang bekanntlich schwer. Und so werden beide Erlebnisse miteinander verbunden. Eine Fahrt fürs Leben. Denn wie es sich für einen echten Seemann gehört, oder vielmehr einen „Seemann der Herzen“, trage ich meinen Containerfrachter jetzt als Tattoo auf dem Arm, gestochen im Hafenviertel von Buenos Aires.
Das Schiff
„Cap San Marco“ (Containerschiff der Cap-San-Klasse für die Reederei Hamburg Süd) · Bauwerft: Hyundai Heavy Industries (Südkorea) · Länge: 333,20 m · Breite: 48,20 m · Tiefgang max. 14 m · Höchstgeschwindigkeit: 21 Knoten · Motorisierung: 1 x MAN-B&W-Zweitaktdiesel · Leistung: 55 300 PS, Container-Kapazität: 9600 TEU (davon 2100 mit Kühlanschluss) · gebaute Schiffe in der Klasse: 10
Die Reederei
Die Hamburg Süd (genauer Name: Hamburg Süd-amerikanische Dampfschifffahrts-Gesellschaft; HSDG) mit Sitz in Hamburg ist eine der traditionsreichsten Reedereien Deutschlands. Seit ihrer Gründung 1871 für den transatlantischen Liniendienst hat das Unternehmen sein Geschäftsfeld ständig erweitert und die Marktposition ausgebaut. Seit dem Jahr 2017 gehört die Hamburg Süd zur weltgrößten Containerreederei, der dänischen Maersk-Gruppe, besteht jedoch auch weiterhin als eigene Marke. Ihre Flotte umfasst derzeit 700 Schiffe. www.hamburgsud-line.com
Die Person
Bevor Phillip Gätz, geboren 1983 in Bielefeld, seinen Weg als Fotograf in Hamburg begann, lag 2010 noch anderer Weg vor ihm: Im Rahmen seines Fotografie-Studiums legte er als Diplomarbeit eine 1111 Kilometer lange Wanderung durch Deutschland zurück, seine „Reise in den Verstand“, Vorgänger der „Fahrt in den Verstand“, wie er das jüngste Abenteuer getauft hat. Heute arbeitet er als Fotograf unter anderem für Kunden wie Beck’s, Coca-Cola, die Deutsche Bahn oder Microsoft, außerdem für Magazine wie BOOTE, „Men’s Health“, „Rolling Stone“ oder „Spiegel“.
Das Projekt
Anfang 2019, nach einer Reihe von Schicksalsschlägen und Enttäuschungen, will Gätz einfach nur weg – möglichst weit – aber nicht wieder zu Fuß. Er erinnert sich an seinen Kindheitstraum: per Containerschiff um die Welt. Die Idee steht, die Umsetzung noch lange nicht. Es folgen Monate der Recherche, mit dem Aufbau sozialer Kanäle und einer Webseite. Parallel holt er sich Partner wie BOOTE, den Ausrüster Globetrotter und Olympus Kameras ins Boot, um Reedereien zu überzeugen und „Bilder gegen Koje“ zu tauschen. Es vergehen weitere Monate voller Absagen, bevor es plötzlich schnell geht: Hamburg Süd bietet ihm an, auf große Fahrt zu gehen, von Hamburg bis Buenos Aires. www.phillipgaetz.de, www.fahrtindenverstand.de
Dieser Artikel erschien in der BOOTE-Ausgabe 09/202o und wurde von der Redaktion im Dezember 2023 überarbeitet.